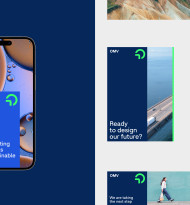Unter dem Begriff „Smart Living” versteht Wikipedia das „Intelligente Wohnen” – welches wiederum technische Verfahren im privaten Wohnbereich bezeichnet, bei denen Geräte eingesetzt werden, die aufgrund einer Datenvernetzung und Fernsteuerbarkeit zusätzliche Funktionen bieten. Bei „Smart Building” denkt das Netz unter anderem an Bürogebäude, Flughäfen oder Einkaufszentren.
Aber was bedeuten diese Begriffe tatsächlich? Was verstehen die Experten darunter? Und welche Bedeutung wird dieses Thema in der Zukunft einnehmen?
Der Bereichsleiter real:estate bei der Volksbank Wien, Martin Rosar, bringt das Dilemma auf den Punkt – denn was heiße schon ‚smart': „Dieses Wort hat einen großen semantischen Hof.” Es bedeute viel, sage aber wenig aus, denn jeder verstehe für sich etwas anderes darunter. (Das Wort ‚Taschenrechner' hat einen kleinen semantischen Hof, Anm.)
Planung sollte intelligent sein
Erich Benischek, Geschäftsführer der Blauen Lagune, versteht unter Smart Living alles von der intelligenten Planung bis hin zu all den technischen Features. Dabei sei die Planung eines der wichtigsten Elemente, dazu aber gehören auch alle Themen der Nachnutzung.
Worüber man sich laut Benischek viel zu wenig Gedanken macht, ist die Frage: „Wie geht es dem Menschen, wenn er älter wird? Es ist eine Zumutung, dass man diese Lebensphase ausklammert. Wir haben Gebäude gebaut, die dieser Lebensphase nicht entsprechen. Die Frage müsste lauten: ‚Wie bauen wir Gebäude, die generationengerecht sind?' Ich vermeide ganz bewusst den Begriff ‚barrierefrei', denn ‚barrierefrei' wird immer gleich mit Behinderung gleichgesetzt.” Dabei wäre für Benischek die Vergrößerung von Wohnflächen gar nicht notwendig – was gebraucht werde, sei eine intelligente Planung – und man müsse wissen, was der Markt an technischen Features hergibt.
Smart versus nachhaltig
„Intelligente Planung kann man sehr unterschiedlich sehen”, meint Architekt Klaus Duda. Gebäude sollten nach seinem Ermessen möglichst nachhaltig, möglichst langlebig sein und zugleich auch adaptierbar auf neue Herausforderungen. Denn momentan sei es doch so: „Wir planen jetzt Häuser, die in zwei Jahren stehen. Meistens dauert es vom Kennenlernen des Grundstücks bis zur Fertigstellung des Gebäudes in etwa fünf Jahre – und dann soll das Haus 50, 70 oder 100 Jahre seinen Dienst erfüllen.” Oftmals werde bei der Planung jedoch ein weitaus kürzerer Zeitraum der „Diensterfüllung” herangezogen und die Aspekte Budget und Zielgruppe in den Vordergrund gerückt.
Dass smart und nachhaltig kein Widerspruch sein muss, erklärte Erich Benischek anhand der Planung eines Einfamilienhauses unter der Berücksichtigung des selbstbestimmten Wohnens im Alter: „Irgendwann wird eine 24 Stunden rund um die Uhr-Betreuung gebraucht. Die ist nur dann sympathisch, wenn die Betreuerin nicht im Wohnzimmer schläft und das gemeinsame Bad benützt, weil ältere Menschen haben damit keine große Freude.” Die klassische Situation sei laut Benischek ja folgendermaßen: Man hat ein Haus, und da mittlerweile Home Offices modern geworden sind, hat man daher im Erdgeschoß keinen Wirtschaftsraum mehr, dafür aber eben dieses Home Office – im Idealfall über Jahrzehnte hinaus. „Wenn ich am Anfang für ein paar 100 Euro Mehraufwand Rohinstallationen berücksichtige, habe ich zunächst das Home Office, später wird aus dem Home Office ein Fitnessraum, und irgendwann, wenn ich die Betreuung brauche, setze ich zwei Wände und eine Türe, mach die Sanitärkeramik, ein paar Fliesen und habe ohne großen Aufwand, noch dazu in einer Lebensphase, wo ich vielleicht nicht mehr das Geld dazu habe, das Mini-Appartement für die 24h-Betreuung. Das ist ein Haus, das mit meinen Lebensphasen nachwächst”, meint Benischek.
Möglichst nutzungsoffen sollten die Strukturen sein, damit sie smart sein können. Die Wandlung von der Hochgarage in ein Bürohaus ist keine Utopie, sondern tatsächlich so passiert. Eine Studie des Architektenbüro Duda zeigt nun: Es ist auch möglich, daraus Wohnungen zu machen – smart und nachhaltig.
Der Ist-Zustand
„Dieses smarte Haus wäre wohl schön und gut, aber …”, ließen sich die Sichtweisen von Karl Fichtinger, Geschäftsführer der Immo-Contract, und Bernhard Raffelsberger, Geschäftsführer Familienwohnbau gemeinnützige Bau und Siedlungsgesellschaft, zusammenfassen. Denn ein Einfamilienhaus sei ja nun doch etwas anderes als der Wohnungsbau, gibt Raffelsberger zu bedenken: „Im Bereich des Geschoßwohnbaus ist es immer schwieriger, als beim eigenen Haus.” Smart bedeutet für den Vertreter gemeinnütziger Bauträger kompakt geschnittene, kleine Wohnungen zu besonders günstigen Konditionen.
Der Ist-Zustand in den Großstädten sei ein anderer, so Fichtinger: „Wir dürfen auch eines nicht vergessen, wir reden ja schon fast ein bissel flapsig, die Masse in Wien ist Substandard oder Standard und da musst halt was daraus machen.” Also auch dem bereits Bestehenden die Vorzüge und technischen Features der smarten Bauweise angedeihen lassen. Nicht immer einfach – die Gesetze nicht immer smart. „In jedem Bundesland haben wir eine eigene Bauordnung, gemeinsam mit der Kammer macht das zehn”, beklagt Fichtinger. Erich Benischek sieht hier die Politik am Zug und fordert Reformen, denn: „Die Gesetzgebung war smart. Jetzt haben wir Hunderttausende Gesetze und Richtlinien. Wir haben dringenden Handlungsbedarf!”
Dazu ein Beispiel aus der Praxis: „Das alte Finanzamt in der Wiener Nußdorferstraße wurde abgerissen und man hatte eigentlich einen schönen Bauplatz”, so Fichtinger. Errichtet wurde ein Neubau – auf den alten Keller drauf. Zwei Geschoße, mit ein wenig statischer Anstrengung sogar drei Geschoße wären, meint die Expertenrunde, für Garagenplätze baulich möglich gewesen. Am Geld sei es auch nicht gelegen. Allein: Der Bauherr hat den quasi Kellerumbau nicht baubewilligt bekommen, so ein Insider.
Smarte Finanzierung
Aus einer Vorsorgewohnung eine betreute Wohnungs-Vorsorgewohnung machen, wäre für Martin Rosar eine Möglichkeit der smarten Finanzierung, mit dem Hintergrund: Im Worst Case könnte der Anleger dort selber einziehen. Er hat dann eine Eigentumswohnung, die bereits im Vorfeld barrierefrei geplant wurde. Zum Beispiel ohne Badewanne, dafür mit einer größeren Duschkabine.
Smarte Finanzierung könne auf jeden Fall nicht einfach die Finanzierung einer smarten Wohnung bedeuten. Ansonsten gäbe es bei der Finanzierung nichts Neues zu erfinden. „Smarte Finanzierung ist den Bedürfnissen angepasst. Das gibt es im Prinzip schon, wenn man es machen will. Das wäre zum Beispiel ein an die Bedürfnisse angepasster Kredit, der sich in der Laufzeit verändern kann”, so Rosar. Wie wäre das möglich? „Ich mache mir im Vorhinein aus, dass ich mit meiner 25-jährigen Laufzeit die Kreditrate zwei oder drei Jahre aussetzen kann. Oder halbieren. Oder wie immer ich das will”, erklärt Rosar, denn: „Dann wird das gleich zu Beginn, bei der Kreditvergabe, mitvereinbart. Damit ich später, wenn eine Ratenaussetzung mal aus den Lebensumständen heraus nötig sein sollte, nicht als Bittgänger zur Bank kommen muss.” Andernfalls wäre man schnell in den ganzen aufsichtsrechtlichen Thematiken „geflaggt” – stehe quasi unter Beobachtung, weil man einmal eine Rate gestundet haben wollte.
Smarte Technik
Last, but not least bricht Ingo Lorenzoni, Vertriebsvorstand der ERGO Versicherung AG, eine Lanze für das Thema, bei dem wahrscheinlich die meisten an Smart Living denken: die Technik. Vieles sei möglich, das meiste lasse sich unter Komfort und Sicherheit subsumieren, ist sich die Expertenrunde einig. Telefonie, Hausregelung – von der Heizung bis zur Beleuchtung, bis hin zur Musikwahl, abgestimmt auf Nutzer und Uhrzeit – alles ist realisierbar. Touch Tables könnten da der neue Renner werden, mit eingebautem (Medikamenten-)Scanner, der zum Beispiel Wirkstoff und Bedienung vorliest. Gerade für die Älteren gäbe es da schon vieles, spricht Klaus Duda aus der Praxis. Unter anderem Wasserhähne oder Matten, die auf unterschiedliche Art und Weise übermitteln können, ob es dem Nutzer (noch) gut geht.
Genau hier sieht der Architekt die Schwachstellen im technisch basierten Smart Living: Was dem einen ein erhöhtes Sicherheitsgefühl gibt, ist für den anderen ein grober Eingriff in seine Privatsphäre. Und: Ein heute technikaffiner Mensch hat keine Probleme damit – aber was wolle man als „Graureiher” lieber: am medizinischen Tablet herumwischen oder mit dem Hausarzt persönlich sprechen? Viele Ältere wären schon heute mit den aktuellen „Gimmicks” überfordert – von den Kosten gar nicht zu reden.
Eine Pflegevorsorgeversicherung wäre hier schon möglich: „Wenn du für sie privat vorsorgen willst, dann musst du lange Zeit ansparen, weil die Mengen an monatlichen Geldern ständig zur Verfügung stehen. Man hat also lange Laufzeiten. Kurz: Wenn du Pflege über private Systeme machst, dann musst du Kohle haben”, meint Ingo Lorenzoni. Pferdefuß dabei: In jungen Jahren fehle der Wille, aber noch öfter das verfügbare Geld für eine brauchbare Pflegevorsorgeversicherung. „Später wäre wohl genug Geld da, da bringt man mit der kurzen Laufzeit nichts Brauchbares mehr zusammen”, so Lorenzoni.
Intelligenter Wohnraum, der uns im Idealfall bis zum Lebensende begleitet, technologische Trends und Gimmicks, bis hin zu Finanzierungsmodellen, fasste medianet-Herausgeber Oliver Jonke die smarte Runde zu Smart Living zusammen.