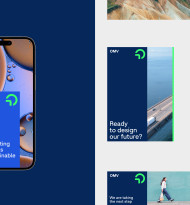BRÜSSEL. Der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter), Facebook, TikTok und mehreren Google-Diensten drohen künftig Geldstrafen, wenn sie nicht stärker gegen illegale Inhalte vorgehen. Ab heute, Freitag, sind bestimmte Regeln für 19 sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen in der EU rechtlich durchsetzbar. Die Unternehmen müssen zum Beispiel Kinderpornografie oder Terrorpropaganda schneller als bisher entfernen.
"Mit dem 'Digital Services Act' setzen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung einer modernen, sicheren und transparenten europäischen digitalen Landschaft", begrüßte Florian Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung, die Neuerung am Freitag in einer Aussendung. Auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) betonte, der heutige Tag markiere einen weiteren Meilenstein in der gemeinsamen europäischen Bekämpfung von Hass im Netz: "Österreich konnte mit dem Kommunikationsplattformengesetz vorangehen und bereits bisher sicherstellen, dass Hass im Netz Konsequenzen hat."
Für Nutzerinnen und Nutzer wird es einfacher, illegale Inhalte zu melden. Online-Marktplätze wie Amazon sind nun verpflichtet, gefälschte Produkte oder gefährliches Spielzeug so gut wie möglich zu entfernen und die Käuferinnen und Käufer zu warnen. Außerdem müssen die Konzerne der EU-Kommission regelmäßig berichten, inwiefern ihre Plattformen etwa die psychische Gesundheit oder die Meinungsfreiheit gefährden. Hintergrund ist das neue EU-Gesetz über digitale Dienste (Digital Service Act, DSA). Für sehr große Plattformen und Suchmaschinen mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern im Monat sieht das Regelwerk sehr strenge Vorgaben vor. Denn aus Sicht der EU geht von ihnen ein besonders großes Risiko für die Gesellschaft aus.
Dabei gehe es nicht nur um die Entfernung illegaler Inhalte, sondern auch um "die Rechte der Nutzer in Bezug auf Datenschutz", so Tursky. Denn: "Die Benutzerinnen und Benutzer haben das Recht zu wissen, wie ihre Daten verwendet werden, und haben fortan die Möglichkeit, bestimmte personalisierte Dienste abzulehnen."
Zu den 19 zunächst betroffenen Plattformen und Suchmaschinen gehören neben Zalando, Wikipedia, Booking.com, der Amazon Marketplace und der Appstore von Apple sowie Alibaba AliExpress, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Youtube sowie die Suchmaschinen von Google und Bing. In einigen Monaten sollen die Regeln auch für kleinere Unternehmen gelten, die unter das Gesetz fallen.
Vertreter der Europäischen Kommission unter der Leitung des zuständigen Kommissars Thierry Breton hatten sich im Sommer vor Ort einen Eindruck über die Umsetzung bei den fünf größten Plattformen verschafft. Zu diesem Zeitpunkt seien alle noch "weit weg von einer vollständigen Konformität mit dem neuen Regelwerk" gewesen, hieß es am Freitag aus EU-Kommissionskreisen. Mit der Überprüfung betraute EU-Experten betonten, nun gehe es "heiß her" und sie würden "nicht zögern, Durchsetzungskräfte anzuwenden, wo dies Sinn macht".
Neben harten Sanktionen gebe es aber noch andere Mittel wie einstweilige Anordnungen, wurde betont. Mögliche Strafgelder können bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des betroffenen Unternehmens ausmachen. "In keinem Fall werden wir von null auf Sanktionen gehen", so ein EU-Experte. "Wenn wir Zweifel haben, werden wir in einem ersten Schritt eine Untersuchung einleiten." Konkrete Fälle, in welchen Bereichen oder bei welchen Unternehmen es noch Umsetzungsprobleme gebe, wurden nicht genannt.
Zu den derzeit vom DSA betroffenen Plattformen könnten noch weitere kommen: Entweder, wenn Plattformen selbst die Überschreitung der 45-Millionen-Nutzer-Schwelle deklarierten, oder wenn die Kommission Hinweise habe, dass dies der Fall sei. Dies sei bei einigen Porno-Plattformen der Fall. ChatGDP sei ein Sonderfall, da die "ursprüngliche Version nicht unserer Definition einer Plattform entsprach". Aber der KI-Chatbot entwickle sich weiter, weshalb die Kommission ihn im Auge behalten will.