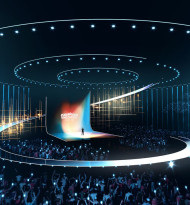WIEN. Seit Beginn der Corona-Krise überschlagen sich die Ereignisse. Viele Auswirkungen haben wir am eigenen Leib miterlebt, vieles aus den Medien oder dem Bekanntenkreis erfahren, über einiges haben wir uns mangels Betroffenheit oder Information vielleicht noch gar keine Ge-danken gemacht und viele Effekte sind noch schwer abzuschätzen oder werden erst im Laufe der Zeit erkennbar. Wer sich aber inmitten dieser Ausnahmesituation schon einmal gefragt hat, wie man sich in 20, 50 oder 100 Jahren an die Corona-Krise erinnern wird, stellt schnell fest, dass Museen dabei eine zentrale Rolle und Verantwortung übernehmen. Denn neben dem publikumswirksamen Ausstellungsbetrieb sind Museen durch ihre Sammeltätigkeit Gedächtnis-speicher der Gesellschaft – eine Funktion, die vor diesem historischen Hintergrund vermehrt ins Bewusstsein gerückt ist.
Das Technische Museum Wien geht aber einen Schritt weiter und ergänzt seine Sammlungs-strategie um die Methode des „Rapid Response Collecting“. Dabei werden Neuzugänge mit Aktualitätsbezug umgehend ausgestellt, um einen öffentlichen Diskurs über besonders bewe-gende Entwicklungen der Gegenwart zu fördern. Beinahe unmittelbar nach der temporären Schließung des Museums zur Eindämmung von COVID-19 wird somit bereits die erste Pop-up-Installation „Corona Impact: An-Denken in 17 Stationen“ gezeigt, die die Auswirkungen der Krise thematisiert.
Die Struktur der Pop-up-Installation orientiert sich an den von den Vereinten Nationen verabschiedeten 17 Sustainable Development Goals (kurz SDGs), die seit Antritt des neuen Generaldirektors Peter Aufreiter im Jänner 2020 im Leitbild des Technischen Museums Wien verankert sind. Dabei handelt es sich um eine weltweit empfohlene Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030, in der 17 Ziele mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Handlungsfeldern definiert werden.
In „Corona Impact: An-Denken in 17 Stationen“ wird evaluiert, welche Auswirkungen die Krise auf das Erreichen dieser Ziele hat und ob sich dadurch neue, bisher nicht vorhersehbare Hürden ergeben haben. Dabei wird beispielsweise untersucht, welche bestehenden Ungleichheiten oder Missstände durch die Corona-Krise sichtbarer oder verschärft wurden oder welche Lehren wir für Klimawandel und Umweltschutz ziehen können, die durch den Lockdown nur eine kurz-fristige Verschnaufpause erfahren haben. Gleichzeitig sind BesucherInnen eingeladen, sich auch in andere – vielleicht fernere – Lebensrealitäten hineinzuversetzen und zu reflektieren, wie Hygienemaßnahmen ohne Zugang zu sauberem Wasser aussehen oder wie Kinder und Jugend-liche E-Learning erlebt haben. Auch das eigene Handeln darf hinterfragt werden: Haben wir uns von irrationalen Ängsten zu Hamsterkäufen verleiten lassen und wie viele und welche Daten sind wir bereit für Komfort oder ein subjektives Sicherheitsgefühl preiszugeben?
Zwar ist die globale Pandemie noch nicht überwunden und bleibt weiterhin medial und gesell-schaftlich präsent, dennoch kehrt langsam wieder etwas Normalität in unseren Alltag ein. Die österreichweit erste Museums-Schau über die Auswirkungen von COVID-19 möchte Besucher-Innen zur kritischen Auseinandersetzung mit unserer „neuen Ausgangslage“ anregen und die Vielfalt an Folgen in Kontext setzen. Die Pop-Up-Schau steht unter dem Motto „Informieren, Sensibilisieren, Diskutieren und Partizipieren“ und gliedert sich dazu in zwei Teile:
Raum für Begegnung und Diskurs im Museum
Anhand der 17 Sustainable Development Goals werden die Auswirkungen der Krise in 17 Stationen exemplarisch präsentiert und beleuchtet. Ausgestellt werden Objekte, die durch Sammelaufrufe oder durch direkte Akquise in die Sammlung des Museums aufgenommen wurden, ebenso wie plastische Inszenierungen der Bühnenbildnerin Nora Pierer. Die Installa¬tion dient als Impulsgeber, um gesellschaftlich relevante Fragestellungen wie auch das eigene Verhalten kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig soll dadurch auch eine Plattform für Dialog und Diskurs geschaffen werden, die BesucherInnen zur gemeinsamen Reflexion einlädt und im Sinne der Aufarbeitung zum persönlichen Austausch über das bisher Erlebte anregt.
Vertiefende Auseinandersetzung im „Digitalen Museum“
Zusätzlich geben kurze Videos vertiefende Einblicke zu konkreteren Aspekten und Statistiken, um für die Vielfalt an Folgen zu sensibilisieren. Die Videos werden dazu im neu gegründeten Youtube-Channel des Technischen Museums Wien öffentlich zur Verfügung gestellt und sind in der Ausstellung mittels QR-Code abrufbar.
Durch die schier endlose Weitläufigkeit der Effekte und die weiterhin anhaltenden Ketten-reaktionen, versteht sich die Pop-up-Installation nicht als endgültige und vollständige Analyse aller Auswirkungen der Corona-Krise. Vielmehr ist das Publikum ebenso aufgefordert, sowohl vor Ort als auch auf dem Youtube-Channel seine eigenen Erfahrungen und Informationen zu teilen und zu diskutieren. Außerdem können Interessierte auch partizipativ an der Gründung einer neuen Sammlung mitwirken. Das 10-Megabyte-Museum sammelt ausschließlich digitales Material und setzt derzeit einen Themenschwerpunkt auf die Corona-Krise. (red)