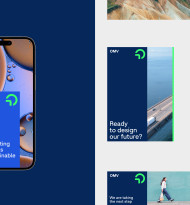WIEN. Es ist üblich, Epochen nach dem dominanten Material zu benennen – Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Wir leben eindeutig im Kunststoffzeitalter, denn Plastik ist allgegenwärtig. Vom simplen Plastiksackerl für den täglichen Einkauf über die Gehäuse von Unterhaltungselektronik bis zu Hochleitstungskunststoffen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie gibt es kaum einen Bereich, der ohne Plastik auskommt.
Laut einem aktuellen Bericht des Weltwirtschaftsforums und der Ellen-MacArthur-Stiftung ist zwischen 1964 und 2014 die weltweite Produktionsmenge von Kunststoffen von 15 Mio. auf 311 Mio. Tonnen gestiegen, für 2025 gehen die Prognosen von mehr als 620 Mio. Tonnen aus, und bis 2050 wird sich die Menge auf über 1,1 Mrd. Tonnen fast verdoppeln. Damit verstärken sich klarerweise auch die bereits bekannten Probleme rund um die Frage „Wohin mit all dem Plastik nach der (meist kurzen) Nutzung?“ Naheliegend ist das Recycling. Weltweit werden heute allerdings erst 14% aller Kunststoffverpackungen (dem größten Anwendungsgebiet) gesammelt und gerade einmal 5% recycelt.
Mehr Recycling
Aber selbst in Europa, einem Vorreiter der Kreislaufwirtschaft, werden von den jährlich anfallenden 25,8 Mio. Tonnen Plastikmüll nur knapp 30% recycelt, rund 40% immerhin energetisch wiederverwertet. Der Rest von rund 8 Mio. Tonnen landet auf Deponien. Bis sich ein handelsübliches Plastiksackerl zersetzt hat, dauert es rund 400 Jahre; Plastikflaschen brauchen 450 Jahre, allerdings sind hier die Recyclingraten durch funktionierende Sammelsysteme und ausgereifte industrielle Aufbereitungsmethoden und Maschinen deutlich höher – weltweit rund 55%. Österreichische Unternehmen zählen dabei zu den weltweit führenden Anbietern. So hat etwa Starlinger recycling technology, ein Geschäftsbereich des Kunststoffmaschinenherstellers Starlinger, weltweit High-End-Systeme für PET Bottle-to-Bottle-Recycling mit einer Gesamtkapazität von über 450.000 Jahrestonnen installiert, unter anderem bei Extrupet, dem größten PET-Flaschenrecyclingunternehmen in Südafrika.
Zu den Weltmarktführern zählt auch die EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H., die kürzlich erst mit dem Inventum, dem Preis für das innovativste Patent des Jahres, ausgezeichnet wurde. Mehr Nachhaltigkeit und Ökologie sollen auch Bio-Kunststoffe bringen, die derzeit aber erst einen Marktanteil von 0,5% haben – Tendenz allerdings stark steigend, wie der aktuelle Marktreport von European Bioplastics zeigt. Bis 2019 gehen die Prognosen von einer jährlichen Mengensteigerung von derzeit knapp 2 auf 7,8 Mio. Tonnen aus. Wie beim normalen Plastik, stellen auch bei den Bio-Kunststoffen Verpackungen das mit Abstand größte Anwendungsgebiet dar, das künftig noch weiter wachsen wird. „Zudem ist mit einem deutlichen Anstieg von Biokunststoffen in den Anwendungsbereichen Textilien, Automobil sowie bei Gebrauchsgütern zu rechnen“, so François de Bie, Vorstandsvorsitzender von European Bioplastics.
Wenig erfreulich sei dabei allerdings, dass 2019 mehr als 95% der Produktionskapazitäten für Biokunststoffe außerhalb Europas liegen werden“, so de Bie weiter. „Um Investitionen und Beschäftigung in diesem Sektor zu sichern, müssen die EU-Mitgliedsstaaten politische und wirtschaftliche Hürden abbauen, die derzeit einen Anstieg der Produktionskapazitäten sowie eine Durchdringung des Marktes mit Biokunststoffprodukten behindern. Es braucht die richtigen Strategien und Rahmenbedingungen, um den Trend umzukehren und die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Potenziale der Biokunststoffbranche in Europa voll auszuschöpfen.“
Neue Materialien
Notwendig sind aber auch kontinuierliche Weiterentwicklungen bei den Bio-Kunststoffen selbst, etwa die Verbesserung der Barriereeigenschaften gegenüber Wasserdampf, Sauerstoff und Geruchsstoffen, wie sie für Lebensmittelverpackungen nowendig sind. Diesem Thema widmet sich etwa das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, das jetzt eine neuartige hybride Kunststoffbeschichtung auf Basis von Biopolymeren entwickelt hat. Für die neuartige Beschichtung modifizierten die Forscher Biopolymere wie Cellulose und Chitosan so, dass man sie verarbeiten kann. Gebunden werden diese Stoffe durch ein anorganisches Gerüst aus Siliciumdioxid, das wiederum selbst über gute Barriereeigenschaften verfügt. Dieses Gerüst zerfällt zwar nicht im natürlichen Abbauprozess wie alle anderen verwendeten Naturstoffe, doch bleiben beim Abbau nur kleine Reste von Siliciumdioxid, sprich Sand, übrig.
Der Abbauprozess wird im Rahmen des bis März laufenden Projekts nach internationalen Normen geprüft, im nächsten Schritt soll der Lack im Pilotmaßstab per Rolle-zu-Rolle-Verfahren auf bioabbaubare Folien aufgebracht werden. Zudem müssen die innovativen Bio-Kunststoffe in etlichen Verpackungstests auch ihre Alltagstauglichkeit beweisen. Einen gänzlich anderen Weg geht das österreichische Start-up Saphium Biotechnology. Basis des neuartigen Bio-Kunsttoffs sind weder Zuckerrübe noch Mais, sondern mikroskopisch kleine Organismen. „Spezielle Mikroben werden mit Wasserstoff und Kohlendioxid gefüttert, die wiederum als Speicherstoff dieses Bio-Plastik produzieren“, erklärt Christof Winkler-Hermaden, CEO des 2015 gegründeten Unternehmens. „Die sonst eher teuren Herstellungskosten von biologischem Plastik werden damit um 50 bis 70 Prozent reduziert.“
Innovation aus Österreich
Und damit sei auch erstmals eine echte Alternative zu herkömmlichem Plastik aus Erdöl auf dem Markt, betont Winkler-Hermaden: „Wir brauchen nur Wasser und Kohlendioxid als Futterstoff. Und davon gibt es genug. Wir sind bereits in Gesprächen mit Industriebetrieben wie der voestalpine als CO2-Lieferanten.“ Ebenso zeige das Saphium-Plastik Eigenschaften, die bislang in verschiedensten Anwendungsbereichen dringend gesucht worden sind: „Unser Bio-Plastik löst sich nicht in Wasser auf – wie etwa Tragetaschen oder Bio-Müllsäcke. Es ist aber gänzlich kompostierbar, denn sobald es in Kontakt mit der Erde kommt, fressen die darin lebenden Mikroorganismen den Stoff wieder auf.“ Zum anderen lasse sich das Granulat wesentlich besser einschmelzen und sei damit vielseitiger einsetzbar, erklärt Winkler-Hermaden. „Unser erstes Produkt werden Filamente für 3D-Drucker sein. Die Patentanmeldung für unser Produkt läuft, im Frühjahr 2016 wollen wir in die Produktion starten.“

Führungswechsel bei Eckes-Granini Austria: Irina Sonnleitner übernimmt Geschäftsführung
Mit 2. Februar 2026 übernimmt Irina Sonnleitner die Geschäftsführung von Eckes-Granini Austria. Sie folgt auf Karin Stainer, die das Unternehmen nach einer zweimonatigen Übergabephase