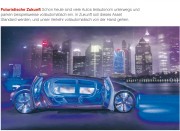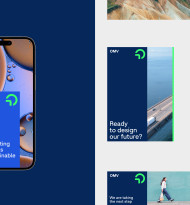Das 19. Jahrhundert ist für uns alle weit weg. Menschen, die aus der Zeit erzählen könnten, leben nicht mehr, und im Geschichtsunterricht geht die Epoche irgendwo zwischen industrieller Revolution, Napoleons Auf und Ab und den beiden Weltkriegen beinah unter. Dabei hat sich zum Ende des 19. Jahrhunderts (vorerst unbemerkt) Historisches ereignet – und zwar genauer im Jahr 1886, als Carl Benz das Patent für seinen „Wagen mit Gasantrieb“ erhält. Zwei Jahre später wagt seine Frau Bertha mit dem Einzylinder-Dreirad eine abenteuerliche Testfahrt von Mannheim nach Pforzheim und bereitet der Technologie damit den Weg in die Zukunft.
Ansichtskarten schlagen Autos
Die Innovation bleibt als solche trotz Berthas spektakulärer Ausfahrt jahrelang unerkannt. Nur wenige Fahrzeuge sind in den Jahren nach Carl Benz’ Erfindung auf den für Autos denkbar ungeeigneten Straßen unterwegs. Im Jahr 1900 werden im Deutschen Reich gerade einmal 800 Automobile zusammengeschraubt, weltweit sind es im selben Jahr knapp 10.000 (siehe auch Grafik unten).
Von der zukünftigen Bedeutung des Automobils ahnen auch die Leser der Berliner Illustrirte Zeitung nichts. Sie sehen in einer Umfrage zum Jahresende 1899 in der Eisenbahn die wichtigste Innovation des Jahrhunderts. Wichtig seien auch die Erfindung der Ansichtskarte und der Gummihandschuhe, der Nähmaschine und der Petroleumlampe gewesen, nur vom Auto ist in der Umfrage keine Rede.
Noch nicht, denn schon wenige Jahre später sind die „fahrenden Kutschen“ in aller Munde. Hauptverantwortlich dafür ist einerseits die immer ausgereiftere Technologie, die nun immer störungsfreiere und längere sowie bequemere und schnellere Fahrten möglich macht (und auch immer mehr Rennen!), andererseits aber mit Henry Ford ein gewiefter Geschäftsmann, der in der Technologie ein potentes Wirtschaftsmodell sieht. Und dieses auch zu nutzen weiß.
1908 stellt der Amerikaner sein Model T vor, kurz darauf beginnt er die Fließbandfertigung des Fahrzeugs und macht damit Autos deutlich billiger und erstmals auch für die breite Masse leistbar. Die globalen Fertigungszahlen verneunfachen sich in der Folge von 1910 bis 1920 auf knapp 2,4 Mio. Fahrzeuge jährlich, die Technologie setzt zum großen Sprung an, und selbst der deutsche Kaiser Wilhelm II, der zuvor noch getönt hatte, weiter an das Pferd zu glauben, denn das Automobil sei „nur eine vorübergehende Erscheinung“, wandelt sich zum „Stinkkarren“-Fan.
Lastwagen lösen nun zunehmend Pferdefuhrwerke ab, Kraftdroschken kommen auf, und der Herr Doktor macht seinen Hausbesuch so selbstverständlich im Auto, wie er noch vor fünf Jahren im Einspänner vorfuhr.
Weitere technologische Fortschritte sind Folge dieser Entwicklung: Robert Bosch erleichtert mit der Erfindung der Magnetzündung das automobile Handling, F. W. Lanchester führt das Zweigang-Planetengetriebe ein, und die Gebrüder Michelin machen den von John Boyd Dunlop ersonnenen Luftreifen für Autos serienreif.
Fertigungszahlen steigen rasant
Längst ist nun das Auto auch als eigenständiges Gefährt klar erkennbar, anfangs ähnelten die Fahrzeuge doch meist noch umgebauten Kutschen, und erste – auch heute noch bekannte – Automobilfirmen entstehen: Lancia, Alfa Romeo und Fiat in Italien, Peugeot in Frankreich, Ford und General Motors (aus einem Zusammenschluss von Oldsmobile, Buick, Cadillac und Oakland entstanden) in den USA sowie Daimler und Benz in Deutschland.
Viele Unternehmer wittern in der Fertigung von Autos das große Geschäft, von 1901 bis 1909 steigt etwa die Zahl der Autohersteller allein in Deutschland von zwölf auf 54 und die Zahl ihrer Angestellten verzehnfacht sich im selben Zeitraum auf knapp 18.000. Auch Vater Staat will an der Nachfrage nach der neuen Technologie partizipieren, ab 1906 kassiert das Deutsche Reich eine Kraftfahrzeugsteuer, um den Fuhrpark des Kaisers zu finanzieren.
Autonome Automobil-Zukunft
Waren sich die Hersteller anfangs in der Wahl ihrer Antriebstechnologie uneins (im Jahr 1900 wurden 40% aller Autos mit Dampf angetrieben, 38% elektrisch und 22% mit Benzin), setzt sich nun zunehmend der Benzinantrieb durch – und die Produktionszahlen steigen weiter: Auf 4,1 Mio. Fahrzeuge im Jahr 1930, zehn Jahre später liegt die globale Fertigung bereits bei rund fünf Mio. Wagen und 1950 erstmals bei über zehn Mio. Stück.
Und der Run geht weiter: Die Produktionszahlen steigen – und in ihrem Schlepptau auch die Zahl der Verkehrstoten. Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre zählen die Statistiker auf heimischen Straßen beinahe 3.000 Verkehrstote – pro Jahr! Die Technologie forderte ihre Opfer, also werden nun zusehends Sicherheits-Features (verpflichtend) eingeführt. Nackenstützen, Gurtpflicht und Konstruktionsverbesserungen greifen rasch und ebnen den Weg zum modernen Automobil, wie wir es heute kennen.
Morgen schon wird die Technologie aber wieder ganz anders aussehen. Antriebs-Alternativen bahnen sich ihren Weg, teilautonome Fahrzeuge sind schon heute Realität, und spätestens 2025 sollen unsere Autos dann – geht es nach Zulieferer Continental und vielen Herstellern – sogar gänzlich ohne unser Zutun vollautomatisch unterwegs sein. 140 Jahre nach Carl Benz Patentantrag steuert die automobile Evolution damit ihrem (vorläufigen) Höhepunkt entgegen.

Starker Anstieg bei rechtlicher Beratung für Journalisten
Die Beratungsfälle des Rechtsdiensts Journalismus nehmen zu. Suchten Journalisten von Herbst 2022 bis 2023 noch 66 Mal rechtlichen Rat, war es von Herbst 2024 bis 2025 mit 118 fast