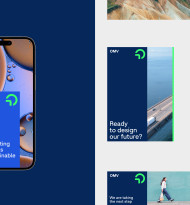"Europa verliert im internationalen Vergleich an Wettbewerbsfähigkeit", heißt es seitens der WKÖ - vor allem die USA hätten sich in den letzten Jahren von der EU bzw. der Eurozone abgesetzt. Die konsequente Vertiefung des europäischen Binnenmarkts könne jedoch für die EU entscheidende Impulse liefern, um im globalen Wettbewerb wieder aufzuholen. Gleichzeitig wächst innerhalb der EU die Divergenz unter den Mitgliedsstaaten, insbesondere innerhalb der Währungsunion: "Wenngleich von einem Zerfall der Eurozone im Moment nicht mehr die Rede ist, bestehen die strukturellen Probleme in der Währungsunion weiterhin, mit Nachteilen auch für die österreichische Wirtschaft."
Binnenmarkt als Wachstumsmotor
Seit dem Amtsantritt der neuen Europäischen Kommission von Jean-Claude Juncker vor über einem Jahr ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit als Voraussetzung für mehr Wachstum und Beschäftigung stärker in den Mittelpunkt gerückt. Angesichts der verhaltenen Wachstumsdynamik in der EU und des steigenden Produktivitätsverlustes insbesondere gegenüber den USA ist das eine positive Entwicklung. In strategischen Bereichen, die jedenfalls europäische Lösungen erfordern und großes Wachstumspotenzial für die europäische Wirtschaft bergen, wurden erste Grundsteine gelegt und konkrete Umsetzungsvorschläge vorgelegt. Diese betreffen in erster Linie die weitere Vertiefung des Binnenmarkts, der nach wie vor Europas größter Wachstumsmotor ist.
Mit dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen versucht die Europäische Kommission ein Zeichen gegen die anhaltende Investitionsschwäche in Europa zu setzten. Zusätzlich könne die Umsetzung der europäischen Kapitalmarktunion die Unternehmensfinanzierung wesentlich verbessern und neue Möglichkeiten für Investoren schaffen. Damit Unternehmen von den Chancen der zunehmenden Digitalisierung optimal profitieren können, brauche es einen europäischen Rechtsrahmen. Ein gemeinsamer Energiebinnenmarkt sei notwendig, um die Versorgungssicherheit in Europa zu wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten. Nicht zuletzt werden die Initiativen zur besseren Rechtssetzung einen wesentlichen Beitrag zum Bürokratieabbau auf europäischer Ebene leisten.
Allerdings sind die Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in erster Linie auf Ebene der Mitgliedsstaaten sicherzustellen, nicht zuletzt durch eine produktivitätsorientierte Lohnentwicklung. Für die Wettbewerbsfähigkeit sind viele Faktoren aus unterschiedlichen Politikbereichen ausschlaggebend: eine leistungsfähige Infrastruktur, gut ausgebildete Fachkräfte, Innovationen, funktionierende Finanzmärkte, eine leistbare und verlässliche Energie- und Rohstoffversorgungen und nicht zuletzt die Qualität der rechtlichen Rahmenbedingungen und der öffentlichen Verwaltung. Entscheidungen aus anderen Politikbereichen haben oft direkten oder indirekten Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit und damit auf das Wachstumspotential und die Beschäftigungsentwicklung. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit könne deshalb auf lange Sicht nur durch einen horizontalen Ansatz gelingen, der sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene konsequent verfolgt wird.
Strukturelle Probleme belasten Eurozone
In punkto Wettbewerbsfähigkeit haben sich die EU-Mitgliedstaaten in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Von einem hohen Grad an wirtschaftlicher und sozialer Konvergenz ist man selbst innerhalb der Eurozone weit entfernt: "Die massive Divergenz in der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere innerhalb der Währungsunion, stellt eine Herausforderung dar, die es für Europa in den nächsten Jahren zu lösen gilt, wenn die Gemeinschaftswährung langfristig Bestand haben soll." Wenngleich in den letzten Jahren Fortschritte gemacht worden seien, bleibe das europäische Regelwerk der gemeinsamen Wirtschaftspolitik in seinem Charakter unverbindlich. Solange die wesentlichen Treiber der Wettbewerbsfähigkeit in die einzelstaatliche Zuständigkeit fielen, liege auch die Verantwortung für die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion letztendlich in den Mitgliedsstaaten und nicht in Brüssel.
Fazit für Österreich
Das Fazit für Österreich: "Um Konvergenz herbeizuführen und die EU und insbesondere die Eurozone weiterzuentwickeln, sind Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in allen EU-Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung der jeweiligen komparativen Vorteile notwendig. Aufgrund der starken Verflechtung der österreichischen Unternehmen mit europäischen Handelspartnern profitiert Österreich in jedem Fall von mehr Stabilität und Konvergenz innerhalb der Eurozone. Divergierende Entwicklungen hingegen schwächen die Eurozone und Europa insgesamt, und damit auch die österreichische Wirtschaft. Mit dem langsam einsetzenden Aufschwung muss das Vertrauen in Europa nun weiter gestärkt werden, um die Investitionsschwäche endlich zu überwinden und die Produktivitätsverluste der letzten Jahre wieder aufzuholen. Dazu sind Anstrengungen auf europäischer wie nationaler Ebene notwendig, insbesondere auch in Österreich." (red)

Starker Anstieg bei rechtlicher Beratung für Journalisten
Die Beratungsfälle des Rechtsdiensts Journalismus nehmen zu. Suchten Journalisten von Herbst 2022 bis 2023 noch 66 Mal rechtlichen Rat, war es von Herbst 2024 bis 2025 mit 118 fast