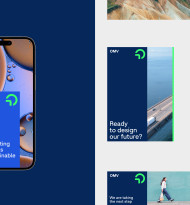WIEN. Die auf den ersten Blick provokante Aussage des Agrarökonomen und Trägers des alternativen Nobelpreises, Hans Herren, „Nahrungsmittel sind viel zu billig“ – hat einen realen Kern. Herren zufolge würde es aufgrund der niedrigen Preise zu Verschwendung kommen und nachhaltig erzeugte Produkte hätten es schwer, sich durchzusetzen. In Entwicklungsländern geht viel bei der Produktion verloren, in Industrieländern bei Vertrieb und Haushalten. Herren ist außerdem der Meinung, dass die aktuellen Preise nicht die ganzen Kosten widerspiegeln. Wenn man die „wahren Kosten" erfassen würde, inklusive Klimaschäden, Bodenverschlechterung und Gesundheitsfolgen, dann wäre heute schon nachhaltig produziertes Essen günstiger als industriell erzeugtes: „Wir kaufen im Supermarkt billig ein, aber für Umwelt und Gesundheit zahlt dann die Gemeinschaft", kritisierte Herren am Montag im Gespräch mit der APA. Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter erinnerte an den Leitspruch der Wintertagung: „Billig gibt's nicht".
Sowohl Rupprechter als auch Herren sehen den permanenten Wachstum in der Produktion kritisch. Wachstum ja – aber „nicht dieses“. Vielmehr ginge es um Ressourceneffizienz. „Das wird das wichtigste Thema der nächsten zwei Jahrzehnte“, prognostiziert der Landwirtschaftsminister. Von Umverteilung wolle er nicht reden, denn das klinge so, als ob jemand zugunsten anderer auf seinen Wohlstand verzichten müsse. In Wahrheit gehe es darum, den eigenen Wohlstand zu erhalten und zugleich anderen Menschen die Teilhabe an diesem zu ermöglichen. Grundsätzlich müsse die Landwirtschaft auch nicht ihre Produktion erhöhen, denn die Welt erzeuge jetzt schon doppelt so viele Nahrungsmittel - gemessen an den Kalorien - wie benötigt, rechnete Herren vor. Dafür bedarf es, so Herren, regional angepasster moderner und ökologischer Produktionsmethoden in der Landwirtschaft. Damit könne man häufig rasch eine Verdreifachung der Ernte erreichen und damit Umwelt und Ressourcen schonen. Es sei zum Beispiel erstaunlich, dass immer noch Bauern mit dem Pflug arbeiten, obwohl man heute wisse, dass das Aufbrechen des Bodens für Mikroorganismen wie auch für die Umwelt schlecht ist.
In Österreich arbeiten inzwischen bis zu 30 Prozent der Bauern „minimalinvasiv", schätzt Rupprechter. Weltweit wäre das Potenzial aber noch groß. Ziel müsse es sein, dass der Boden nach dem Produktionszyklus besser da steht als davor, so Herren. Je mehr Humus, desto mehr CO2 aus der Luft werde gebunden. Aber der Weg dorthin führe einerseits über die Umstellung von Gewohnheiten, was Schulung und Ausbildung verlangt, andererseits über Investitionen in andere Maschinen. Gelinge aber die Umstellung, dann sei die Landwirtschaft weniger abhängig von Wetterschwankungen und könne einen konstanteren Ertrag liefern.
Gerade in Afrika gebe es derzeit eine „enorme Fehlinvestition" aufgrund des „missionarischen Ansatzes der US-Agrarpolitik", so Rupprechter. Die Amerikaner arbeiteten nach dem Motto „wir ernähren die Welt" und setzen voll auf US-Gentechnik, aber das sei sicher ein Irrweg, ist sich Rupprechter mit Herren einig. Dazu komme der Landverkauf an chinesische Großfirmen, die von Afrika aus die chinesische Bevölkerung ernähren wollen. Dabei habe Afrika als Kontinent sicher das Potenzial, die Bevölkerung zu ernähren. Setzte man hingegen auf lokale, an die regionalen Bedingungen angepasste Produktion, könnte sich Afrikas Bevölkerung rasch selbst ernähren. (APA/red)