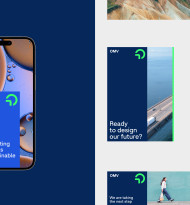••• Von Chris Radda und Georg Sohler
Seit mehr als 30 Jahren treibt die Altstoff Recycling Austria (ARA) die Kreislaufwirtschaft in Österreich voran. Harald Hauke begleitet diesen Prozess seit mittlerweile 13 Jahren, fünf davon als Vorstand des heimischen Marktführers unter den Sammel- und Verwertungssystemen. Er kennt das Verhältnis der Österreicher zum Sammeln von Altstoffen ganz genau. Im Rahmen der retail.conversations nahm er im medianet-Studio bei Herausgeber Chris Radda Stellung zu den wichtigsten Themen seiner Branche.
Dabei zeigt sich vor allem eines: Österreich ist beim Sammeln von Verpackungen vorbildlich – und die Menschen sind sich durchaus bewusst, wie wichtig es ist, Altstoffe als neue Rohstoffe zu recyceln. Möchte man aber den CO2-Fußabdruck generell verringern, muss man an zahlreichen Stellen ansetzen. Auch dafür sucht und findet die ARA Antworten.
Lob für die Stakeholder
Eines der Felder, in dem die Konsumenten auf die ARA treffen, ist der Lebensmitteleinzelhandel. Hier, im „Kerngeschäft”, erreicht Österreich in Sachen Verpackung bereits alle Zielvorgaben (Sammel- und Recyclingquoten) der Europäischen Union – bei Glas, Metall und Papier sogar schon jene, welche die EU für 2030 vorgibt. „Auch bei Kunststoff wurde bereits sehr viel unternommen, um die Recyclingziele zu erreichen”, erklärt Hauke. „So haben wir etwa das Sammelsystem vereinfacht, mit TriPlast die größte und modernste Kunststoffsortieranlage Europas sowie die Anlage Upcycle für chemisches Recycling von Kunststoffresten eröffnet.”
Der LEH ist gut unterwegs: „Hier wird in Sachen Kreislaufwirtschaft optimiert und perfektioniert.” Derzeit versuchen Lieferanten und Handel das Verpackungsdesign zu verbessern, um beispielsweise nur noch ein einziges Material zu verwenden. Diese „Monoverpackungen” lassen sich leichter in den Kreislauf zurückführen. Wo kann man da überhaupt noch besser werden?
Der Gurken- und der Käsefall
Aus Haukes Sicht bieten sich hier vor allem zwei Chancen: am Feld sowie beim Transport zum Konsumenten an den Point of Sale. Ein gutes Beispiel dafür, dass Plastik nicht immer schlecht ist, repräsentiert die Gurke. Ist diese foliert, hält sie „zwei- bis dreimal so lange, andernfalls trocknet sie aus. Auch beim Käse muss man beispielsweise bedenken, ob der Käse durch eine andere Verpackungslösung nicht schneller verdirbt. Das wäre der falsche Weg.” Denn gerade beim Käse macht die Verpackung laut Hauke nur drei Prozent des Carbon Footprints aus.
Das heißt: Den Impact von guten Verpackungen für Lebensmittel kann man auch anhand der Lebensmittelverschwendung einordnen. Global gesehen landen 30–40% der Lebensmittel im Müll – dieser Umstand verursacht rund zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen.
Dass Verpackungen getrennt gesammelt werden sollen, wissen die Menschen übrigens sehr genau: Laut einer IMAS-Umfrage stehen rund 90% der Österreicher hinter der getrennten Verpackungssammlung. Die Kooperation mit dem LEH sowie umfassende Umweltbildungsprogramme – beginnend in Kindergärten und Volksschulen – tragen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Das soll so bleiben, auch in anderen Bereichen.
Laufend informieren
Zum Thema getrennte Sammlung informiert die ARA laufend und zielgruppenadäquat, denn: „Nichts ist in Sachen Umweltschutz einfacher, als die Verpackung in einen der zwei Millionen Sammelbehälter zu werfen bzw. in den Gelben Sack, der von 2,2 Millionen Haushalten benutzt wird.” Auf diese Weise sammelt Österreich Jahr für Jahr rund eine Million Tonnen Verpackungen und Altpapier. Hunderttausende Tonnen Rohstoffe werden nach der Aufbereitung an die Industrie „zurückgegeben.”
Ein wichtiger Faktor, wie Hauke betont: „Wir sorgen für Rohstoffsicherheit. Die österreichische Glasindustrie kann deshalb wettbewerbsfähig sein, weil sie von uns die Scherben bekommt. Das spart Energie und Kosten. Das gleiche Prinzip gilt für die Papierindustrie. Wir haben eine starke Verantwortung für den Wirtschaftsstandort und die heimische Wettbewerbsfähigkeit.” Nun geht es darum, die nächsten Schritte zu nehmen und die befinden sich außerhalb des Verpackungssektors. Denn: „Die Verpackung macht 1,5 bis zwei Prozent des ökologischen Fußabdrucks eines durchschnittlichen Europäers aus. Wenn es um ein verpacktes Lebensmittel geht, sind es drei bis 3,5 Prozent.”
Nächster Schritt: Kleidung
Doch in Österreich fallen jährlich 220.000 Tonnen Textilien an – und nur 20% davon werden in Form von Altkleidern und Schuhen getrennt gesammelt. Da muss man sich auch politisch etwas überlegen. Eine entsprechende EU-Regulierung, die in eineinhalb Jahren in Kraft tritt, fordert eine bessere Wiederverwertung.
Dafür, so Hauke, brauche es fundierte Forschung, auch wenn es herausfordernd sei, etwa die verschiedenen Fasern und Knöpfe gut zu trennen. Schwieriger sieht es im Bausektor aus. Dieser ist für rund 40% des globalen CO2-Fußabdrucks verantwortlich; gleichzeitig wird nur etwa ein Prozent der dort verwendeten Materialien recycelt. Um das zu ändern, bedarf es der Umsetzung neuer Ideen. So wurde beispielsweise im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von Salzburg Wohnbau und ARAplus Gipskarton wieder aufbereitet.
Die Mine der Zukunft
„Es gibt also größere Hebel – Verpackungsrecycling allein wird das Klima nicht retten”, unterstreicht der ARA Vorstandssprecher. Pro Jahr verursacht jeder Mensch in Österreich 500 kg Siedlungsabfall (von Verpackungen bis Sperrmüll). Rechnet man Landwirtschaft und Abwasser hinzu, verzehnfacht sich die Menge. Das ergibt zehn Tonnen Material pro Jahr und Einwohner in Österreich an „anthropogenem Lager”. Dieser Ausdruck beschreibt die Rohstoffe, die für den täglichen Gebrauch verwendet werden.
„Wir fokussieren uns da immer auf diese 500 Kilogramm, aber wir müssen nachdenken, wie wir die zehn Tonnen pro Jahr zurückholen können”, ortet Hauke hier hohes Potenzial. „Das ist die Mine der Zukunft.” Dieser Umstand hat auch handfeste wirtschaftliche Auswirkungen. Denn Österreich und Europa verfügen über wenige Primärrohstoffe. Somit muss man aufbereiten, was man schon importiert hat.
Forschen für die Zukunft
Für die Erforschung und Entwicklung derartiger Projekte für Ressourcenmanagement kooperiert die ARA mit zahlreichen Forschungseinrichtungen: „Ohne Forschung hätten wir unsere Sortieranlage nicht bauen können und europaweite Patente wie für die Polyolefin-Aufbereitungsanlage nicht anmelden können. Wir haben so viele gute Leute und eine Menge an technologischen Ideen. So können große Schritte in Sachen Kreislaufwirtschaft gemacht werden.” Davon profitiert schlussendlich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Kundschaft der ARA und der Konsument. Schließlich hat man trotz der Liberalisierung des Marktes vor zehn Jahren großes Vertrauen in der Wirtschaft und teilt das Know-how mit 16.000 Kunden und 4,5 Mio. Haushalten.
Für die Weiterentwicklung investiert das Unternehmen in eigene hochmoderne Anlagentechnik. Man berät Wirtschaft und Industrie bei der Entwicklung von individuellen Kreislauf-Lösungen und unterstützt dadurch eine nachhaltige Wertschöpfung. Für die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft brauche es entsprechende Rahmenbedingungen – die neue EU-Verpackungsverordnung müsse durch „sinnvolle nationale Begleitgesetze” ergänzt werden, damit Unternehmen rechtssicher agieren und Innovationen fördern können. Dann, so Hauke, könne Österreich weitere Verbesserungen rasch umsetzen und die „low hanging fruits” einsammeln.