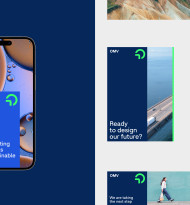••• Von Georg Sohler
Der Jänner hieß für viele Menschen und auch für den LEH (seit 2014) wieder einmal „Veganuary”. Das Wort selbst triggert viele. Es ist auch nicht so, dass sich laut einschlägigen Befragungen eine Vielzahl an Menschen vegan ernähren würde. Dennoch werden die rein pflanzenbasierte Produkte sowie das „V-Label”, das anzeigt, dass keine tierischen Erzeugnisse enthalten sind, im LEH mehr.
Die Anzahl derer, die nur und ausschließlich vegan essen, liegt im einstelligen Prozentbereich, aber viele Menschen ernähren sich zusehends von weniger tierischen Produkten. Auch offiziell hält das Gesundheitsministerium die Menschen an, weniger Fleisch zu essen. Was bedeutet das nun für die Landwirtschaft? Und wie motiviert man mehr Menschen, den Fleischkonsum zu reduzieren, wie es die Gesundheitsexperten empfehlen? medianet hat dazu Hannes Royer (Bio-Bauer, Land schafft Leben) als Vertreter derer, die nicht auf tierische Produkte verzichten wollen, sowie Felix Hnat (Aktivist, Vegane Gesellschaft) ausführlich befragt.
medianet: Herr Royer, Ihr Bauernhof ist 800 Jahre alt, seit 250 Jahren in Familienbesitz. Wie viel Angst haben Sie vor Menschen wie Herrn Hnat?
Hannes Royer: Überspitzt gesagt hat natürlich jeder Betrieb, der Tiere hält, Angst. Schließlich ist jeder, der aufhört, Fleisch zu essen oder Milch zu trinken, ein verlorener Kunde. Wenn ich in meiner Funktion als Obmann von Land schafft Leben durch Österreich fahre, erlebe ich diese Haltung auch regelmäßig. Die tierhaltende Landwirtschaft erkennt oft nicht, dass es hier nicht um ‚entweder, oder', sondern um ‚sowohl als auch' geht – und dass es eigentlich keinen Grund zur Angst gibt. Stattdessen eskaliert es oft schon, wenn das Wort ‚vegan' nur genannt wird.
medianet: Herr Hnat, würden Sie dem Herrn Royer gern die Tiere wegnehmen?
Felix Hnat: Ganz und gar nicht. Alle veganen Menschen, die ich kenne, ernähren sich auch von landwirtschaftlichen Produkten. Es gibt in der veganen Community einen großen Respekt vor der Landwirtschaft. Ich habe selbst während Corona versucht, im Garten ein Gemüsebeet anzulegen, Unkraut zu jäten, Schnecken zusammenzuklauben und Tomaten angebaut, hochgebunden und bewässert – am Schluss der Saison sind vier oder fünf Kilo rausgekommen. Da habe ich erst so richtig bemerkt, wie die heimische Landwirtschaft es schafft, in einer super Qualität unheimlich wertvolle Produkte herzustellen. Und jene, die weniger Fleisch essen, essen mehr Hülsenfrüchte, Getreide und Gemüse. Wenn man weniger vom einen isst, isst man eben mehr vom anderen. Da sehe ich auch ein großes Potenzial für die österreichische Landwirtschaft. Diese kämpft, Soja ist aber ein Erfolgsbeispiel – es gibt Zuwächse bei Fläche und Produktion.
medianet: Woher kommt diese Polarisierung?
Royer: Essen ist etwas sehr Intimes und damit auch eine sehr emotionale Angelegenheit. Wenn dann jemand mit erhobenem Zeigefinger kommt und uns vorschreibt, was wir essen dürfen und was nicht, dann wollen wir das nicht. Gerade in den Anfängen der veganen Bewegung ist das aber immer wieder vorgekommen. Das bringt aber nichts, sondern bewirkt eben nur, dass man sich noch weiter voneinander entfernt. Felix und ich würden nie auf die Idee kommen, uns gegenseitig vorzuschreiben, was wir essen sollen. Genau darum geht’s: Man kann Bewusstsein schaffen und Menschen aufklären. Social Media verstärkt diese Polarisierung leider. Da wird zum Beispiel immer wieder die Milchwirtschaft angegriffen. Die Milchkuh gehört aber seit 8.000 Jahren zu unserer Kultur, und in Österreich haben wir neben Irland die EU-weit klimafreundlichste Milchproduktion. Warum sollte ich mir da Vorwürfe machen lassen – als Bauer, aber auch als Konsument? Viele Vorwürfe basieren auf Unwissen.
medianet: Sind die Veganer zu aggressiv gewesen? Der Anteil an Veganern beträgt hierzulande fünf Prozent, bei den Jüngeren sind es mehr, hinzu kommen Flexitarier.
Hnat: In einer Demokratie muss es möglich sein, einen Diskurs zu führen und Gesetzesverbesserungen zu fordern. Umgekehrt stimme ich Hannes zu, dass unsere Social Media-Welt bedingt, dass sich Polarisierung auszahlt. Wer das am meisten tut, bekommt die meisten Views und die Aufmerksamkeit – siehe Donald Trump. Es gibt auch einzelne Veganer auf TikTok, die unheimlich polarisieren; das macht dann die Runde und wirft ein schlechtes Licht auf jene, die sich pflanzlich ernähren oder wenig Fleisch essen. Das hat aber nichts mit der Einstellung der breiten Masse der Veganer zu tun. Jeder Veganer hat im engsten Umfeld die unterschiedlichste Ernährungsansätze. Und: Es gibt auch im Bereich der Landwirtschaft jene, die stark polarisieren, satirisch unterwegs sind und Reichweite haben.
medianet: Von außen wirkt es schon sinnvoller, das Soja gleich zu verarbeiten, als der Kuh zu verfüttern und diese aufwendig zu verarbeiten. Wenn jetzt jemand verbieten würde, Fleisch zu produzieren, könnte die Landwirtschaft uns dann versorgen?
Royer: Also bei einer Sache sind wir uns wohl einig – wir sollten weniger Fleisch essen. Es ist erwiesen, dass es aus gesundheitlicher und auch ökologischer Perspektive Sinn macht, mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen. Komplett auf tierische Lebensmittel zu verzichten, ist aber nicht zielführend. In der Diskussion gibt es für mich zwei Punkte: Pro Kilogramm Pflanzenmasse entstehen in Österreich geschätzte sechs bis sieben Kilogramm nicht essbare Pflanzenmasse. Einen großen Teil dieser nicht essbaren Masse verfüttern wir an unsere Nutztiere und machen ihn so in Form von Milch und Fleisch essbar. Ohne Tierhaltung müssten wir einen großen Teil wegwerfen, weil wir keine Verwendung dafür hätten. Das wäre eine extreme Ressourcenverschwendung. Und der zweite Punkt: Zwei Drittel der Agrarfläche weltweit sind Grünland und nur ein Drittel Ackerland. Auf Grünland kann man nur schwer etwas anbauen, das geben Topografie und Klima einfach nicht her. Man kann es nur durch Wiederkäuer wie Rinder für die menschliche Ernährung nutzbar machen. Rein rechnerisch würde es sich mit dem Drittel Ackerland wahrscheinlich ausgehen, wenn alle nur noch Ackerfrüchte essen – dazu gibt es auch Studien. Aber dann stellen sich andere Fragen wie jene nach einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Als Veganer sollte man sich diese Dinge schon auch vor Augen halten.
medianet: Den Faktor ‚Landschaftspflege' sollte man aus verschiedenen Gründen nicht vergessen …
Royer: Unsere Kulturlandschaft, so wie wir sie kennen, gibt es nur, weil es die tierhaltende Landwirtschaft gibt. Und diese Landschaft ist der Hauptgrund, warum Millionen Menschen ihren Urlaub in Österreich verbringen und hier Wandern und Skifahren gehen. Sie ist also ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ich will betonen, dass die Milchwirtschaft in Österreich nach wie vor sehr kleinstrukturiert ist. ‚Industriebetriebe' mit Tausenden Tieren gibt es nicht.
medianet: Diese Industrialisierung findet ja wohl niemand gut, genauso wenig wie Bauern begrüßen werden, was beispielsweise der VGT aufdeckt. Aber Bio gibt es wohl nicht ohne konventionell. Was wäre denn ein Tierhaltestandard, mit dem man leben könnte?
Hnat: Bio ist super, egal ob pflanzlich oder tierisch. Mir ist ganz wichtig, festzuhalten, dass niemand irgendjemand etwas verbieten will. Jeder soll das selbst entscheiden und ich denke, dass sich politisch einiges ändern muss – Verbote gehören da sicher nicht dazu. Nehmen wir Kopenhagen her. Da wurde die öffentliche Verpflegung auf Bio umgestellt, die Quote liegt zwischen aktuell 85, sie war schon einmal auf 95 Prozent. Man verteufelt Fleisch nicht, verwendet es aber eher als Gewürz, die Menge sinkt dann. Und die neuesten Ernährungsempfehlungen umfassen seit 2024 nur noch 32 Gramm Fleisch pro Tag bzw. 28 Gramm Fisch. Das sind 230 Gramm pro Woche. Laut Land schafft Leben-Website essen Männer aber 900 bis 1.000 Gramm Fleisch pro Woche und Frauen auch noch um die 500 – weit mehr, als empfohlen. Man muss auch ehrlich sagen, dass 50 Prozent des Getreides, das wir hierzulande anbauen, verfüttert werden und 500.000 Tonnen Soja werden nach Österreich importiert. Die Bereiche Rinder und Geflügel setzen mit Selbstverpflichtung auf heimisches Futter, der Großteil des Soja geht aber in die Schweinefleischproduktion. Und in Österreich wird am meisten Schweinefleisch gegessen.
medianet: Wie kommen wir von dieser stark industrialisierten Fleischproduktion letztlich weg?
Royer: Tierwohl und Co. sind angeblich allen wichtig, am Ende wird aber das billige Vollspaltenbodenfleisch am meisten verkauft. Mit der Inflation hat sich das noch verstärkt – die breite Masse bewegt sich gerade eher weg von der Qualität. Jetzt können wir natürlich die Produktion auf dem Vollspaltenboden verbieten. Aber wir sind in der EU. In Ungarn oder anderen Ländern im Osten kennt man das Wort ‚Tierwohl' nicht einmal. Und solange die Menschen keine anderen Kaufentscheidungen treffen, importieren wir das billige Fleisch dann eben von dort. Das ist hart, aber so ist es leider. Deshalb ist Bewusstseinsbildung auch so wichtig. Verbote allein reichen nicht.
medianet: Der LEH macht viel, Rewe hat mit Billa Bio eine weitere Marke eingeführt, Spar bewirbt die Eigenmarke stark. Das Angebot wäre da – warum wird es nicht angenommen?
Hnat: Man sieht in den letzten Jahren schon, dass weniger Fleisch gegessen wird, es nimmt jährlich um mehr als ein Kilo ab, im letzten Jahrzehnt laut Statistik Austria um 10,9 Kilogramm. Die pflanzlichen Angebote sprießen aus dem Boden, der Veganuary ist sehr erfolgreich, es gibt tolle heimische Start-ups in dem Bereich. Ich würde mir da beispielsweise wünschen, dass die Ungleichbehandlung von Kuhmilch und pflanzlichen Drinks wie Soja und Hafer – einmal zehn, einmal 20 Prozent MwSt. – abgeschafft wird. Die Rohstoffe für die Drinks kommen aus Österreich. Und laut Boku könnten wir mit einem um 20 Prozent reduzierten Fleischkonsum von Futtermittelimporten unabhängig werden. Man könnte auch die gesetzlichen Mindeststandards etwas anheben, auch bei Tierhaltung+ von AMA. Öffentliche Ausschreibungen könnten sich daran orientieren und das verhindert viel Billigfleisch. Die Politik kann hier Rahmenbedingungen schaffen. In Dänemark fördert der Staat den Anbau von Hülsenfrüchten, so profitiert die Landwirtschaft. Das ginge hier auch. Laut Land schafft Leben ist der Konsum von Hülsenfrüchten um 71 Prozent gestiegen, der Anbau aber nicht im gleichen Ausmaß.
Royer: Diesbezüglich waren wir mit Rewe im Gespräch. Die Mengen sind leider noch sehr gering. Die veganen Fleischalternativen machen laut Nielsen 0,9 Prozent aus in ganz Österreich. Die meisten Erbsen aus konventioneller Landwirtschaft kommen aus Frankreich, die in Bio-Qualität aus Kanada. Der Weg ist sehr weit. Der gesamte LEH inkl. Diskont sagt, dass die Kurve nicht mehr steigt, sondern stagniert.
Hnat: Da kenne ich andere Zahlen. RollAMA- und GfK-Zahlen belegen, dass es ansteigt. Bei Milch ist es schon weitaus mehr und die erwähnte Zahl stimmt für Fleischalternativen. Aber man kann auch Bohnen vom Neusiedler See essen.
medianet: Wobei sich die Methodik bei Nielsen und Roll-AMA unterscheidet. Das ändert alles nichts daran, dass wir zu viel Fleisch essen. Was braucht es? Schockbilder wie auf Zigarettenpackungen?
Royer: Es kann mir heute niemand mehr erklären, dass er nicht weiß, was ein Vollspaltenboden ist. Der VGT kampagnisiert seit mehr als 20 Jahren dagegen und es wird so viel Bewusstseinsbildung von verschiedensten Organisationen betrieben, man muss schon blind und taub sein, um das nicht mitzubekommen. Wenn es ums eigene Geld geht, dann blenden wir das aber gerne einfach aus, so ehrlich müssen wir sein. Wir wissen ja auch, dass Billiggemüse aus dem EU-Ausland von chinesischen Wanderarbeitern geerntet wird und die heimischen Paradeiser sind um ein paar Cent zu teuer. Beim Essen sind wir gnadenlos.
medianet: Und wie geht es dann?
Royer: Der Felix und ich sind ja befreundet. Wenn ich das anderen Bauern erzähle, gibt es immer wieder welche, die mich fragen, warum ich überhaupt mit ihm rede. Aber genau darum geht es: dass bei all den Diskussionen der Mensch im Vordergrund steht. Es geht um Verständnis. Dann esse ich eben einmal etwas Veganes, auch wenn ich weiß, dass es umgekehrt wahrscheinlich nicht passieren wird. Man muss sich wegen so etwas nicht die Schädel einhauen. Wir müssen wieder lernen, uns gegenseitig zuzuhören und hin und wieder eine andere Sichtweise einnehmen als unsere eigene. Dazu tragen Organisationen wie Land schafft Leben oder die Vegane Gesellschaft mit ihrer Arbeit gleichermaßen bei, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Ansätze vertreten – oder gerade deshalb.
medianet: Ich denke auch, man muss die Gerichte auch erst kennenlernen. Die meisten Veganer kennen konventionelle Küche, umgekehrt seltener. Ich höre von Gastronomen, dass ‚vegan' nicht so nachgefragt wird.
Hnat: Früher hat es ja fast gar nichts gegeben. Ich habe neulich eine Studie dazu gelesen, dass, wenn es vegan/vegetarisch als eigene Sektion neben ‚Hauptspeise' auf der Karte gibt, die Menschen nur Hauptspeise lesen und von dort etwas bestellen. Wenn man die pflanzlichen Speisen kommentarlos in die Hauptspeisensektion aufnimmt, steigen die Bestellungen um 127 Prozent. Ich würde empfehlen, nicht ‚vegan', sondern pflanzenbasiert draufzuschreiben. Was schmeckt denn besser? Spaghetti vegan oder Penne mit frischem Basilikumpesto und Pinienkernen? Bei einem steht ‚Ideologie' im Vordergrund, beim anderen das Geschmackserlebnis. Da werden in der Gastronomie viele Fehler gemacht, obwohl wir aus dem LEH wissen, dass 95 Prozent der veganen Produkte wie Haferdrink oder Tofu von Flexitariern gekauft werden. Das ist die wesentliche Zielgruppe.
medianet: Im LEH liegt der vegane Lachs neben dem echten …
Royer: Ich kann diese Eindrücke bestätigen. Je mehr man es emotionalisiert, desto mehr verhärten sich die Fronten. Das bringt aber nichts. Am Anfang war es vielleicht gut, aber mittlerweile redet auch der LEH eben nicht mehr von vegan, sondern nur noch von pflanzenbasiert.
medianet: Vielleicht schlägt der Gedanke des Veganuary dann auch auf viele andere über. Etwa so, dass man – wenn schon – qualitativ hochwertiges Fleisch kauft.
Hnat: Es gibt Zwänge und Gewohnheiten, die verhindern, dass wir nicht das tun, was wir gerne machen würden. Der Veganuary setzt ja hier an, bei den Neujahrsvorsätzen. Er zeigt aber nicht mit dem Finger auf etwas und kritisiert Fleisch und Milch – es wird einfach ein Platz angeboten, dass Firmen neue Produkte auf den Markt bringen können, man den Markt testen kann und die mediale Aufmerksamkeit nutzen kann. Es gibt über 10.000 Medienartikel weltweit zu dem Thema. Davon profitieren alle. Es kann ja nur positiv sein, wenn man den eigenen Trott verlässt. Vielleicht hört man nicht mit Fleisch auf, aber kauft öfter einmal Bohnen vom Neusiedler See.