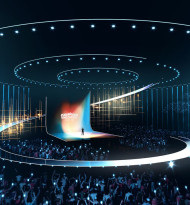••• Von Andreas Zeuch
In der Politik wurden demokratische Systeme oft auf den Barrikaden erkämpft. Im Unternehmen hingegen ist Demokratisierung immer eine Revolution von oben. Jede Transformation muss über das Top-Management laufen. Denn die Geschäftsführung oder der Vorstand hat zu Beginn die zentrale Entscheidungsgewalt bei sich versammelt. Dies ist zum einen aus formalen Gründen des jeweils geschlossenen Gesellschaftsvertrags notwendig. Schließlich erfreuen sich die Geschäftsführer oder Vorstände nicht nur der Entscheidungsmacht, sondern tragen andererseits auch ein zum Teil nicht unerhebliches Risiko – selbst dann, wenn es sich nur um angestellte Top-Führungskräfte handelt. Martin Winterkorn könnte im Zuge des Dieselgate-Skandals nicht nur eine finanzielle Strafe blühen, die durch seine D-&-O-Versicherung nicht mehr gedeckt ist, es könnte im für ihn vermutlich schlimmsten Fall sogar zu einer Haftstrafe kommen. Wer in der obersten Führungsposition ist, überlegt sich durchaus zu Recht, ob er Entscheidungen mittragen möchte, die andere für das Unternehmen fällen und von denen er möglicherweise nicht überzeugt ist. Zum anderen müssen sich alle, die ein Unternehmen führen, fragen, ob sie den eigenen Gestaltungsspielraum einschränken wollen.
Demokratisierung von oben
Bei allen demokratischen Unternehmen, die ich besuchte und deren Geschichten ich zu verstehen versuchte, wurde der Wandel tatsächlich stets von oben initiiert. Die Transformation weg vom Top-down beginnt also genau mit dem Phänomen, das eigentlich überwunden werden soll. Wenn sich dann die Führungsspitze entscheidet, den eigenen Willen zur Macht für die Belegschaft zu öffnen, folgt daraus aber erstens noch längst nicht, dass die Mitarbeiter begeistert die neue Mitgestaltungsmöglichkeit ergreifen. Zweitens gibt es das Risiko, dass gruppenpsychologische Effekte dazu führen, dass faktisch am Ende ebenfalls wieder die Platzhirsche die Führung ergreifen. Dann wird die mit der Demokratisierung gewünschte Meinungsvielfalt, Multiperspektivität und deutlich breitere Informationsbasis für Entscheidungen nicht genutzt. Warum ist das so, und wie kann dieses Problem gelöst werden?
Verantwortung verweigert
Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir erzeugen im Laufe der Zeit bestimmte Meinungen, Welt- und Menschenbilder und damit verbundene Abläufe, Prozesse, Rituale. Wir stehen nicht jeden Morgen auf und beginnen als Tabula rasa. Wir brauchen gewisse Routinen. Genauso verhält es sich auch bei unserer Arbeit. Jeder neue Mitarbeiter kommt mit der Anstellung in ein soziales System, das bereits eine Vielzahl an Regeln, Routinen und Ritualen aufgebaut hat. Er muss sich einfügen, anpassen. Das soziale System des Unternehmens kann sich nicht mit jedem neuen Mitarbeiter komplett neu erfinden. Aus diesem Grund stellt sich zu Beginn einer Demokratisierung unter anderem eine entscheidende Frage: Welche Unternehmenskultur und -struktur hat sich bis dahin gebildet? Wenn das Unternehmen bis dahin formal-fixierte Hierarchien mit den dazugehörigen zentralistischen Top-down-Entscheidungen aufweist, wird sich die Belegschaft auf genau diese Form eingestellt haben. Die Mitarbeiter mussten dem Folge leisten, ansonsten wären sie nicht Teil des Systems geworden und geblieben.
Im Laufe der Jahre haben sie sich darin eingerichtet, keine oder nur sehr begrenzte Verantwortung zu übernehmen. Sie wurden zu Erfüllungsgehilfen des Top-Managements. Ihre Aufgabe bestand klassischerweise darin, auszuführen und nicht selbstständig zu denken und zu entscheiden. Wer unter diesen Bedingungen blieb, hat sich damit in letzter Instanz einverstanden erklärt. Fakt ist aber auch, dass diese Adaption an die bestehende Command-and-control-Kultur Auswirkungen auf die intrinsische Motivation, die Arbeitszufriedenheit und -leistung sowie die Krankenfehlzeiten hat. Wer das menschliche Grundbedürfnis nach Selbstbestimmung und damit den Wunsch, das eigene Leben zu kontrollieren, in der Arbeit aufgibt, befindet sich eines Tages in einer paradoxen Situation: Einerseits macht sich Frustration breit, wenn man nur ein humanoider Roboter ist. Andererseits hat man im Arbeitsleben nicht oder nur unzureichend gelernt, Verantwortung zu übernehmen.
In manch einem Unternehmen, das sich heute demokratisieren will, bekamen die Mitarbeiter gestern Probleme, wenn sie zu eigenständig handelten. Ist es dann verwunderlich, wenn nach zehn, zwanzig oder gar dreißig Jahren der Anstellung in einem solchen Unternehmen die Mitarbeiter nicht sofort „juhu” schreien und das Zepter der Gestaltungsmacht ergreifen? Wer das ernsthaft erwartet, sollte besser die Finger von der Demokratisierung lassen. Denn diese Denkfigur in Form einer Erwartung verweist auf ein mechanistisches Menschenbild, das völlig untauglich für Unternehmensdemokratie ist. Menschen sind keine Roboter, denen man nur ein neues Programm hochladen muss, damit sie sich anders verhalten.
Fehlerfreundlichkeit
Wenn das Tor zur Macht von der Unternehmensführung geöffnet wird, stellen sich zwei Fragen: Wollen die Mitarbeiter mitgestalten, und können sie es? Daraus folgen zwei fundamentale Aufgaben im Prozess der Demokratisierung: Transparenz schaffen und Lernen ermöglichen. Wer seine Mitarbeiter einlädt, zukünftig bei unternehmensrelevanten Entscheidungen mitzuwirken, muss sicherstellen, dass erstens die relevanten Daten für die interessierten Personen zugänglich sind und sie zweitens interpretiert werden können. Ansonsten ist der Wunsch nach Verantwortungsübernahme durch die Mitarbeiter eine peinliche Phantasmagorie.
Um diese vollkommen natürliche Lücke zwischen Wollen und Können zu schließen, braucht die Unternehmensführung zuallererst Vertrauen: in die Mitarbeiter, den Prozess der Transformation und in die Fähigkeit, seine Bereitschaft, die Gestaltungsmacht tatsächlich teilen zu wollen, glaubhaft zu kommunizieren. Danach bedarf es einer ordentlichen Portion Geduld: Weder lassen sich die alten Gewohnheiten wie alte Schuhe einfach ausziehen, noch werden teils komplexe Kompetenzen in vier Wochen gemeistert. Letztlich ist Fehlerfreundlichkeit angesagt. Wenn gewohnte Wege verlassen werden, läuft das Finden neuer Wege, die Entwicklung neuer Entscheidungsprozesse nicht fehlerlos ab. Im Umfeld von Wandel, Komplexität und Dynamik wird immer unter Unsicherheit entschieden werden müssen. Damit ist die organisationale Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen, anstatt sie zu bestrafen, eine unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation.
Allerdings kann in der Zwischenzeit ein anderes Problem auftauchen: Die bisherigen Führungskräfte, die jetzt vielleicht nicht mehr weisungsbefugt sind, übernehmen trotzdem wieder das Ruder, weil es kein anderer macht. Leider hilft da keine Standardlösung, weil die Motive und Absichten ausgesprochen unterschiedlich sein können. Regieren die Platzhirsche wieder, weil sie das Machtvakuum für sich und ihre Eigennutzenmaximierung ausnutzen? Oder greifen sie nur ein, damit das Schiff nicht strandet, wenn sonst niemand die Steuerung mitübernimmt? Laden sie andere zur gemeinsamen Führung ein, oder versuchen sie, einen exklusiven Machtanspruch durchzusetzen? Sind die Platzhirsche in ihrer ehemaligen Führungsrolle durch die neue Situation überfordert, möchten aber die neue Kultur mittragen, oder wollen sie sie doch eher sabotieren?
Personelle Opfer
Die Problematik des entstehenden Machtvakuums, das ausgefüllt werden muss, verdeutlicht einen wichtigen Punkt: Auch die Transformation hin zum gemeinsamen Gestalten und Entscheiden kann personelle Opfer fordern. Manche Führungskräfte brauchen die Weisungsbefugnis als Letztentscheidungsinstrument wie die Luft zum Atmen. Sie würden in einem demokratischen Unternehmen ersticken und müssen gehen. Nicht genauso, aber ähnlich kann es sich mit den Mitarbeitern verhalten, die einfach keine Verantwortung (mehr) übernehmen wollen. Für sie ist es mitunter besser, sich einen neuen Arbeitgeber der alten Schule zu suchen. Einer der großen Vorteile demokratischer Unternehmensverfassungen besteht darin, die kleine, oft homogene Gruppe der Geschäftsführung oder des Vorstands um die Meinungsvielfalt, Multiperspektivität und den größeren Wissensbestand der Belegschaft zu bereichern. Damit kann das Risiko von Fehlurteilen seitens der Unternehmensführung gesenkt werden, sofern es gelingt, die Vielfalt der verschiedenen Mitarbeiter zu nutzen. Denn immer dann, wenn Gruppen zu homogen, mithin zu einfältig sind, laufen sie Gefahr, entscheidungsrelevante Informationen zu übersehen und damit zu schnell einer Meinung zu sein sowie zu sehr an die Überlegenheit der eigenen Entscheidungsfindung zu glauben. Wenn im Vorstand drei Männer um die 45 sitzen, die alle früher Betriebswirtschaft studiert hatten und obendrein noch alle golfen gehen, dann steigt damit die Wahrscheinlichkeit, zu simpel gestrickt zu sein, um die Komplexität der Umwelt erfolgreich zu meistern. Genau deshalb ist es unter anderem aus reichlich rationalen Gründen sinnvoll, mehr Menschen in Entscheidungen zu involvieren.
Das Problem besteht aber in der Folge darin, dass es natürlich noch eine Vielzahl anderer individual- und sozialpsychologischer Fallstricke gibt, die auch vielfältige Gruppen scheitern lassen. Informationskaskaden führen dazu, dass die erste Meinungsäußerung wie ein Attraktor wirkt und die Meinungen der weiteren Gruppenmitglieder in ihren Bann zieht, sodass letztlich alle Folgemeinungen bestenfalls Variationen der ersten Meinung oder Äußerungen sind. Reputationskaskaden haben zur Folge, dass die Mitglieder einer Gruppe mit abweichenden Meinungen befürchten, aus der Gruppe ausgesondert zu werden. Ergo passen sich etwaige Abweichler und Querdenker am Ende doch der Gruppenmeinung an – obwohl vielleicht gerade ihre Sichtweise und die Informationen, auf die sie ihr Urteil aufbauen, für den Entscheidungsprozess besonders wichtig sein könnten. Somit muss in der Demokratisierung Sorge getragen werden, dass diese Verzerrungseffekte nicht auftreten. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten (siehe Kastenelement); mit diesen einfachen Minimethoden kann die Vielfalt von Gruppen genutzt werden. Dann können sie ihre Stärke gegenüber einfältig-homogenen Gruppen ausspielen. Ashby’s Law, wonach mit höherer Varietät ein steuerndes System besser geeignet ist, Störungen im Steuerungsprozess auszugleichen, wird dann Folge geleistet. Mit anderen Worten: Einer der guten Gründe, warum die Demokratisierung von Unternehmen und Organisationen Sinn macht, liegt darin, dass sie komplexer werden müssen, um in einer zunehmend komplexen Umwelt überleben zu können.
Wenn es gelingt, die skizzierten Verzerrungseffekte zu überwinden, steigt die Chance auf eine lösungsorientierte, konstruktive Komplexität des Unternehmens. Der Clou liegt letzten Endes darin, dass genau dadurch die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im Vergleich zur zentralen, klassischen Steuerung steigt.