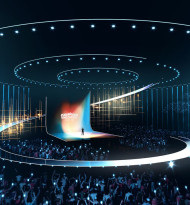••• Von Reinhard Krémer
Auf den Tag genau heute vor 19 Jahren rasten zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers (WTC) in New York City. Dies verursachte nicht nur den Tod von fast 3.000 Menschen und die Zerstörung eines Wahrzeichens, sondern verstärkte auch noch die Aktienkrise, die schon seit dem Jahr 2000 die Tech-Werte erfasst hatte – Stichwort DotCom.
Die im März 2000 geplatzte Spekulationsblase, die insbesondere die sogenannten Dotcom-Unternehmen der New Economy betraf, ließ die Kurse der Tech-Aktien in den Keller rasseln. Doch ein Flächenbrand kündigte sich an.
Denn bereits im Vorfeld des 11. September war es zu massiven Kursverlusten bei den großen Indizes gekommen. So verlor der DAX zwischen 27. August (5406) und dem 10. September 2001 (4670) fast 14%.
Als der Welt klar geworden war, dass es sich bei den insgesamt vier Flugzeugabstürzen nicht um tragische Unfälle, sondern um terroristische Attentate handelte, brach am Börsenparkett blanke Panik aus: Innerhalb weniger Minuten rutschte der deutsche DAX um über 400 Punkte auf 4247 Zähler; er hatte in den vorangegangen Stunden über 8,5% bzw. 56 Md. € an Marktkapitalisierung verloren.
Die Wall Street, die um 9:30 hätte öffnen sollte, blieb geschlossen, da der gesamte Financial District in New York evakuiert worden war. Auch der Dollar brach ein, während Öl und Gold massive Kursgewinne verbuchten.
Auftakt zur Krise
Auch die nachfolgenden Tage brachten den Börsen keine Erholung: Am 21. September erreichten sie im Fahrwasser des geschwächten Dow neue Rekordtiefstände. Der US-Index stand zu diesem Zeitpunkt bei 8235, der DAX bei 3787. Innerhalb einer Woche hatten die an der Wall Street gelisteten Unternehmen über 1,38 Billionen USD an Marktkapitalisierung verloren.
Die Folgen für die Wirtschaft ließen nicht lange auf sich warten: Die USA waren durch den Terroranschlag endgültig in eine Rezession gestürzt. Zwar folgte an den Börsen bis zum Jahresschluss eine V-förmige Erholung, doch war unter anderem das Konsumklima vernichtend getroffen worden – es landete auf einem Stand, des es zuvor Mitte der Neunzigerjahre erreicht hatte.
Damit ist aber auch schon einer der großen Unterschiede zur Coronakrise markiert: Hierzulande wollten die Konsumenten kaufen, die Wirtschaft lief rund – aber sie konnten wegen des Lockdowns nichts erstehen.
Das Mittel der Wahl
Um dem Trend entgegenzuwirken, läutete der damalige Fed-Vorsitzende Alan Greenspan die Zeit des billigen Geldes ein – und legte damit den Grundstein für die nächste Krise.
Zwar hatte er bereits vor den Anschlägen begonnen, den Leitzins der US-Notenbank zu senken. Doch ging es danach noch um einiges weiter nach unten. Zwischen 2001 und 2003 sank der Leitzins von 6,5 auf 1,0%. Das führte dazu, dass die Wachstumszahlen der USA zwar vorerst akzeptabel blieben, doch das die private Verschuldung stieg in gewaltige Höhen.
Um die aktuelle Krise zu bewältigen, griff man nun zu anderen Mitteln, denn die Zinsen liegen bereits am Boden – die Staaten pumpten Geld mit Zuschüssen und Einmalzahlungen in die Wirtschaft. Das erhöht zwar die Staatsverschuldung, doch wenn der Konsum läuft und die Arbeitslosigkeit zurückgeht, wird sich das a la longue durch die gute Steuereinnahmen wieder glätten – so lautete damals das Kalkül der Politik.
Denn eines hatte man aus der Großen Krise, die die Welt nach 2007 zehn Jahre lang beutelte, gelernt: Billiges Geld in Kombination mit mangelnder Kontrolle hat seinen Preis.
Die Krise übertrug sich in Produktionssenkungen und Unternehmenszusammenbrüchen auf die Realwirtschaft. Viele Unternehmen mussten Insolvenz anmelden und entließen Mitarbeiter.
Kommt die Insolvenzwelle?
Hier könnte sich eine Parallele zur aktuellen Situation abzeichnen: Die Corona-Wirtschaftskrise dürfte in zahlreichen Ländern zu mehr Firmenpleiten führen als die Große Rezession infolge der Weltfinanzkrise vor 13 Jahren, zeigt die eben veröffentlichte Insolvenzprognose des weltweit zweitgrößten Kreditversicherers Atradius.
Mit Frankreich, der Schweiz, Belgien und Spanien sind auch mehrere große Außenhandelspartner Österreichs unter den Volkswirtschaften, bei denen es 2020 und 2021 zu Rekordzahlen bei den Firmenpleiten kommen könnte.
„Ein Unterschied zwischen der Großen Rezession und der Corona-Pandemie ist die Vorlaufzeit, mit der die Realwirtschaft die Krise zu spüren bekommt. Während sich das Platzen der US-Immobilienblase vor 13 Jahren erst Monate später auf die Industrie und die einzelnen Branchen auswirkte, haben die im März 2020 einsetzenden Schutzmaßnahmen die Geschäftstätigkeiten aller Unternehmen unmittelbar getroffen”, sagt Franz Maier, Generaldirektor Österreich, Ungarn und Südosteuropa von Atradius.
Monetäre Stabilisierung
„Die anschließend erlassenen Gesetze zur Stabilisierung der Wirtschaft mildern den Konjunktureinbruch und die Insolvenzzahlen zwar noch ab. Dennoch sind die Unsicherheiten im Exportgeschäft bereits jetzt so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr, unter anderem, weil mit den Rettungspaketen auch zahlreiche Firmen am Leben gehalten werden, die unter normalen Bedingungen nicht mehr am Markt bestehen könnten. Die weitere Entwicklung des Zahlungsrisikos im internationalen Handel hängt davon ab, wie die Pandemie in den kommenden Wochen verläuft, welche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen und wie lange Rettungspakete in Kraft sind”, sagt Maier.
Ende der Globalisierung?
Ob das der Globalisierung den Garaus macht, wie es der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel), Gabriel Felbermayr (siehe Kasten S. 5), kürzlich in Aussicht stellte, bleibt abzuwarten.
„Die Coronakrise hat sicher die schon vorher aus anderen Gründen infrage gestellten Trends in Richtung Globalisierung auf eine neue Probe gestellt. Die Abhängigkeiten aufgrund der langen Wertschöpfungsketten sind in der Krise sehr sichtbar geworden”, meint Volksbank Wien-Generaldirektor Gerald Fleischmann.
„Deren Verkürzung mag zwar wirklich zu einer Verlangsamung der Wirtschaft beitragen, die größeren Einflussfaktoren sind aus unserer Sicht aber die Entwicklungen bei Konsum, Arbeitslosigkeit und Nachhaltigkeit. Viele Branchen werden die während der Coronakrise etablierten Entwicklungen beim Homeoffice und der Digitalisierung ebenso nutzen wie die Durchführung ohnehin schon länger notwendiger Effizienzmaßnahmen”, so Fleischmann.
Ein Fallnetz aus Scheinen
Aktuell verhindern die massiven Programme der Staaten und der Notenbanken, dass die Krise voll auf die Wirtschaftszahlen durchschlägt, ist der Volksbank- General überzeugt: „Diese Interventionen werden zumindest bis zur US-Wahl, wahrscheinlich bis über das Jahresende hinaus, fortgesetzt werden. Gleichwohl ist zu bemerken, dass ein nennenswerter Teil dieser Mittel noch nicht in der Realwirtschaft, also im Konsum oder den Realinvestitionen ankommt, sondern gespart oder an den Finanzmärkten veranlagt wird. Denn sowohl die Konsumenten als auch die Unternehmen sind sich bewusst, dass diese Füllhörner nicht ewig offen sein werden, und parken deshalb vorsichtshalber eine gewisse Liquidität für die Zeit nach dem Auslaufen der Stützungsmaßnahmen.”
Den Brexit gibt’s auch noch
Und nachher sind auch einige Probleme wie die Art und Weise des Brexit und die wirtschaftlichen Spannungen zwischen den USA und China zu lösen, meint Fleischmann.
„An den Kapitalmärkten hat man aus den Erfahrungen der Großen Depression und des Ölschocks der 70er-Jahre den Schluss gezogen, dass einfach jede Krise in der Wirtschaft und an den Märkten am besten mit viel Liquidität und raschen Zinssenkungen zu bekämpfen ist. Wie ein Drogensüchtiger aber über die Jahre ständig die Dosis erhöhen muss, brauchen auch die Märkte von Krise zu Krise höhere Dosen an Zinssenkungen und Liquidität”, sagt der Volksbank-General.
Arsenal fast erschöpft
In der aktuellen Pandemie-Krise werden nun die Spielräume bis an die äußersten Limits ausgereizt, für die Lösung einer allfälligen weiteren Krise in den nächsten Jahren ist aus heutiger Sicht nur mehr wenig Munition vorhanden. Gleichzeitig wird der Aufbau von Reserven gegenüber den Krisen der letzten 30 Jahre durch die Tatsache erschwert, dass ein weiterer Entwicklungs- und Nachfrageboom aus den Schwellenländern nicht mehr zu erwarten ist. Die Aktienmärkte haben aufgrund der Unmengen an Liquidität, von der sie anstelle der Realwirtschaft jetzt geflutet werden, einen fulminanten Aufschwung nach den heftigen Korrekturen im März hingelegt, so der Banker.
Die Indices spiegeln dabei aber nicht den breiten Markt. Am Tag, als der Standard and Poors 500-Index Mitte August seinen Höchststand erreichte, notierte die durchschnittliche Aktie im Index rund 30% unter dem jeweiligen Höchstkurs. Dies weckt Erinnerungen an die berühmten Nifty Fifty der 70er- Jahre, als rund 50 Aktien den Index nach oben trugen, so wie heute Apple, Facebook, Google und Amazon.
„Die damaligen Stars wie DEC, ITT, Kodak, Polaroid und Xerox, die als Technologiegiganten für die Ewigkeit galten, verloren im folgenden Jahrzehnt massiv an Wert. Wer garantiert, dass auch die heutigen Stars nicht irgendwann das Schicksal von Yahoo oder AOL erleiden?”, fragt Gerald Fleischmann.