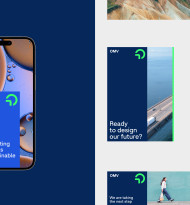WIEN. Das Nordbahnviertel in Wien-Leopoldstadt überzeugt nicht nur mit energieeffizientem Wohnbau, sondern auch mit klimafitten Außenräumen. Bereits 2021 wurde die Bruno-Marek-Allee mit ihren zahlreichen Blumenbeeten und 60 Bäumen – Gleditsien – zum ersten Klimaboulevard Wiens erklärt. Gleditsien tolerieren Hitze, bilden eine ausladende, schattenspendende Krone.
Besser im Verbund
Doch das Viertel setzt auch darüber hinaus Maßstäbe: In der Wohnanlage Nordbahnhof III (Baufeld 1A) wurde das städtebauliche Konzept „Freiraum auf Wohnungsebene” umgesetzt.
„Die Idee verbindet Gebäude und Landschaft durch eine Abfolge urbaner Terrassen. Diese Freiraumlandschaft wächst nach oben und bildet einen hybriden Stadtsockel mit begrünten Ebenen, in dem Wohnen, Gewerbe und soziale Infrastruktur auf innovative Weise miteinander verschmelzen. So entsteht ein Gesamtkonzept aus naturnaher Begrünung, nachhaltiger Landschaftsarchitektur und durchdachter Fassadenbegrünung”, erklärt Dominik Scheuch, Geschäftsführer von Yewo Landscapes, dem Wiener Landschaftsarchitekturbüro, das diese beiden Außenräume im Nordbahnviertel plante.
Die Wohnanlage Nordbahnhof III samt ihrem Freiraumkonzept wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Greenpass-Zertifikat in Gold. Auch hier spielt der Baustoff Beton eine zentrale Rolle.
Durchdachte Methode
„Helle Betonpflastersteine in Kombination mit versickerungsfähigen Flächen wirken nach dem Schwammstadt-Prinzip: Sie regulieren das Regenwassermanagement und helfen, Flächen zu entsiegeln”, sagt Christoph Ressler, Vorstandsmitglied von Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer des Güteverbands Transportbeton. Zusammen mit 41 neu gepflanzten Bäumen sorge dieses Konzept dafür, dass sich die gefühlte Außentemperatur an Hitzetagen in der Wohnanlage, im Vergleich zu vollversiegelten Flächen, um bis zu 14 Grad Celsius reduzieren könne.
Von wegen „schwammig”
Beim Schwammstadtprinzip wird das Regenwasser von der Straße bzw. von einem Platz in den Wurzelraum von Bäumen geleitet und hilft ihnen beim Anwachsen. Dadurch können sich großkronige Bäume in befestigten Flächen besser entwickeln und werden unterirdisch mit Wasser und Luft versorgt.
Das Schwammstadtprinzip funktioniert besonders gut in Kombination mit hellen Betonpflastersteinen und versickerungsfähigen Fugen. Gute Beispiele dafür gibt es etwa auch in Attnang-Puchheim, der ersten Schwammstadt Oberösterreichs, oder im Stadtquartier Wolfganggasse in Wien-Meidling. (hk)