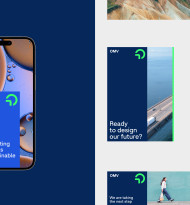Im Silicon Valley fließen Milch und Honig, so das Mantra bezüglich Unternehmenskultur, Innovationen und Start-ups. Ob dabei die Einstellung der Akteure oder die Rahmenbedingungen eine größere Rolle spielen, haben Expertinnen und Experten kürzlich bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Plattform „Digital Business Trends” unter die Lupe genommen.
Professor Burton Lee, Dozent für European Entrepreneurship & Innovation an der Stanford University in Kalifornien, meinte zum Thema: „Über das Silicon Valley-Mindset oder Fehlerkultur zu diskutieren, ist in Ordnung, aber was wir brauchen, sind konkrete Aktionen.”
Seine Forderung: „Wir müssen die Studentenzahl an Universitäten und Fachhochschulen in den Bereichen Software- und Daten-Kultur sowie neue Geschäftsmodelle verzwei- und verdreifachen und rasch – in zwei bis drei Jahren – deutlich mehr Lehrgangsplätze anbieten”, so Lee. Außerdem sollten diese Angebote nicht nur Informatikstudenten zur Verfügung stehen, sondern für alle, von Kunst bis Wirtschaftsstudenten – geöffnet werden, forderte der Innovations-Experte.
Künstliche Intelligenz
Geändert werden müsse auch der Forschungs-Mix – weg von der traditionellen Informatik hin zu Computerwissenschaften und Datenwissenschaften.
Wichtig sei, Bereiche wie Spieleentwicklung und Künstliche Intelligenz, „das Gehirn aller Systeme, die wir künftig nutzen”, zu forcieren. Hier müsste auch mehr Geld in die Forschung gepumpt werden. „Ihr macht zu wenig. Es gibt genug Talent und auch Interesse in Österreich”, verweist Lee auf „brillante Studenten” an heimischen Unis und Fachhochschulen.
Was das Mindset betrifft, gebe es ebenfalls Nachholbedarf, ergänzte Antoinette Rhomberg, Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Werksalon Co-Making Space. So könnten Erfahrungen im Silicon Valley als unternehmerische Frischzellen-Kur wirken.
„Das macht motivierter, inspirierter und mutiger”, so Rhomberg. „In Österreich gehen wir schwanger mit Ideen und besprechen die dann mit Gleichgesinnten”, empfiehlt sie ein „Rausgehen” und „sich der Welt stellen”, denn ein schnelles Scheitern sei einfach billiger.
„Pitch, listen and learn”
In der „Bay Area” um San Francisco habe man ein bis zwei Minuten für einen Pitch, egal ob bei der privaten Grillparty, in der Arbeit oder im Gründungszentrum.
Danach sollte man nach der Einschätzung des Gesprächspartners fragen – „und dann heißt es Mund zu, zuhören und lernen”. Bei mangelndem Interesse würde das Gegenüber sofort sagen: „Interessant, aber nichts für mich.” Das spare beidseitig Zeit und Geld und beende die Konversation. Ansonsten könne man ein konstruktives Feedback erwarten und kein in Österreich weit verbreitetes „Bist du dir sicher?” oder „Hast du dir das auch gut überlegt?”
„USA bitte nicht idealisieren”
„Man muss sich aber schon überlegen, wo man dieses Mindset überhaupt braucht. Wir sollten das nicht idealisieren”, relativierte Sabine Bothe von der A1 Telekom Austria.
Für manche Bereiche sei es gut geeignet, für andere weniger. Selbst organisierte Teams und Design Thinking brauche es nicht überall. Zwar müsse man dieses Mindset auch in große Unternehmen bringen, dort gebe es aber schon Wege zu Innovationen.
„Vielleicht ist es ein bisschen mühsamer, es macht aber Spaß. Unser Start-up-Campus platzt jedenfalls aus allen Nähten”, so Bothe.
In Kooperation mit Talent Garden – laut eigenen Angaben Europas größtes Co-Working-Netzwerk – und weiteren Partnern arbeite man deshalb in Wien an einem neuen Angebot.
Einerseits gebe es Initiativen – vom Kindergarten bis zu Frauen in die Technik, andererseits wäre eine Lösung des Fachkräftemangels sehr einfach, so Thomas Faast von der FH Technikum Wien: „Wir brauchen mehr Programmierer, schicken aber jedes Jahr Hunderte junge Menschen weg, weil wir nicht genug Studienplätze haben.”
Er strich zudem hervor, dass es nicht nur um Software und Programmieren gehe, sondern auch die Hardware wichtig sei – konkret Unternehmensideen, die in die Industrie zurückwirken können. Mit der Gründungsinitiative „Start me up” wolle man die Gründerkultur jedenfalls stärker in das Hochschulleben einbinden.
Es gehe nicht darum, eine kleine Kopie des Silicon Valley anzustreben, so Birgit Hofreiter von der Technischen Universität (TU) Wien; man sollte sich aber ansehen, wie beispielsweise Stanford funktioniere und welche Rolle es im Wachstumsmodell des Valleys spiele.
Die TU bewege sich jedenfalls in die richtige Richtung. Während Studenten früher in Großkonzerne wollten, dann in Beratungsunternehmen, würden sie jetzt vor allem Innovationen umsetzen wollen, etwas bewegen, gründen. „Da entsteht eine neue Berufsgruppe von Innovationsmanagern und Umsetzern”, so Hofreiter.
Zu viel „Show”
„Das Silicon Valley-Mindset ist auch in Österreich vorhanden. Mit Familie ist das aber fast nicht machbar. Am Anfang stehen viele Risiken und wenig Geld”, gab sich Oliver Krizek, Geschäftsführer der Navax Unternehmensgruppe, überzeugt.
Bei Vergleichen hinke man aber wegen eines unterschiedlichen Öko-Systems hinterher, so der Manager, der auch darauf verweist, dass in San Francisco Wohnen sehr teuer sei und es viele Obdachlose gebe. Kritik übte er an der Politik: „Da geht es vor allem um persönliche Eitelkeiten und viel Show. Die Effekte sind aber gering”, so Krizek.
Dass im Silicon Valley nicht nur Milch und Honig fließen, betonte auch Rafael Rasinger von der Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich (WKO).
Allein in San Francisco hätten die Durchschnittsmieten im November 2016 rund 3.700 € betragen – für Nicht-Profiteure der Tech-Industrie kaum leistbar.
Die Außenwirtschaft betreibe bereits seit 2009 die Technologieinitiative „Go Silicon Valley” und habe so ein gewisses Mindset nach Österreich gebracht und das Start-up-Feld aufbereitet. „Der kalifornische Geist ist in Österreich angekommen, jetzt muss er skalieren und in weitere Bereiche kommen”, so Rasinger.
„Wir haben schon eine unheimlich geile Start-up-Kultur und -Szene”, befindet auch Jürgen Schmidt von der Webagentur strg.at. Es herrsche ein offener Umgang, es gebe Netzwerktreffen, an manchen Bereichen müsse man aber noch arbeiten. Verbesserungswürdig seien vor allem die Rahmenbedingungen, wenngleich manche Forderungen überzogen seien: „Sind das die Unternehmen der Zukunft, die es nicht schaffen, eine GmbH zu gründen? Die haben im Unternehmertum nichts verloren, da gibt es viel größere Herausforderungen”, so Schmidt. Grundsätzlich brauche es zum Start nicht viel: „Da reicht oft die viel zitierte Garage – wenn man weiß, wo man hinwill.” (fej/red)