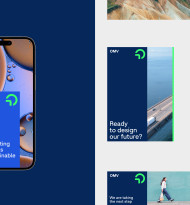Leitartikel ••• Von Sabine Bretschneider
ZWEI PLUS ZWEI. Trumps Wahlsieg im Vorjahr versetzte viele Finanzakteure in wohlige Ekstase – befreit von Regulierung, Steuern und woken Pronomen. „Wir treten in die wachstumsfreundlichste, unternehmensfreundlichste und amerikanischste Regierung ein, die ich in meinem Erwachsenenleben erlebt habe”, schwärmte der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Bill Ackman im Dezember. Am Schwarzen Montag dieser Woche meldete er sich kritisch auf X: „Die Weltwirtschaft wird durch schlechte Mathematik ruiniert. Die Berater des Präsidenten müssen ihren Fehler vor dem 9. April eingestehen und einen Kurswechsel einleiten, bevor er einen schweren Fehler begeht.”
Seitdem kriecht Ackman in seinen Postings zu Kreuze, wurde „missinterpretiert”, unterstützt des Präsidenten Zollpolitik vollinhaltlich und wünscht sich nur mehr kleinlaut eine Pause, bevor der „Hammer zuschlägt”. Das ist nur würdig und recht. Schließlich vollzieht der mehrheitlich gewählte Führer der freien Welt genau das, was er davor jahrelang angekündigt hatte. Er predigte kein Wasser, sondern definitiv Wein. Wer zwei und zwei korrekt addiert hätte …
Am schlimmsten hat der Kursrutsch die Techmilliardäre erwischt, mehrheitlich jene, die zur Inauguration die besten Plätze reserviert hatten. Seitdem segneten etliche Dollar-Billionen das Zeitliche. Was jetzt?
Der US-Präsident beendet die Ära des globalen Freihandels. Das sollte bei Globalisierungskritikern auf Enthusiasmus stoßen: Trumps Zollpolitik erfüllt einige ihrer zentralen Forderungen, etwa den Schutz der Industrie im Inland, die Relokalisierung der Lieferketten, die Stärkung der nationalen Souveränität … Der Finanzhistoriker Marc Buggeln bemängelt, dass es Trump weniger um wirtschaftliche Logik gehe, als vielmehr um ein Gefühl der Rache und des Betrogenseins.
Hätten also ethisch einwandfreie Motive für dieselben Aktivitäten andere Auswirkungen? Nun, wir sind allesamt Teilnehmer an diesem Experiment. Wir werden sehen, wie es endet.