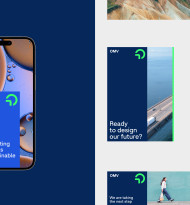WIEN. Der Senat der Wirtschaft warnt in einer Aussendung vor der im Jahr 2024 beschlossenen EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD). Laut dem Senat würde das Regelwerk – obwohl es Menschenrechte sichern, Umweltstandards heben und Kinderarbeit verhindern soll – in der Praxis den Wohlstand und Arbeitsplätze in Europa gefährdet und die sozialen sowie ökologischen Standards weltweit eher verschlechtern.
Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, entlang ihrer gesamten globalen Lieferkette menschenrechtliche und ökologische Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu minimieren. Der Senat der Wirtschaft kritisiert, dass dies für KMU, die weder über die personellen noch finanziellen Ressourcen verfügen, ein kaum leistbarer Kraftakt ist.
Senat der Wirtschaft Vorstandsvorsitzender Hans Harrer kritisiert die Verordnung daher scharf: „Besonders kleine und mittlere geraten durch die Auflagen unter enormen Druck! Sie sollen komplexe, globale Lieferketten eigenständig auf Menschenrechts- und Umweltverstöße prüfen. Ein Aufwand, der selbst Großkonzerne an ihre Grenzen bringt und für viele KMU existenzbedrohend ist!“ Weiters erklärt er: „Was als ethischer Fortschritt gedacht war, entwickelt sich zu einem praxisfernen Bürokratiemonster. Der Mittelstand wird mit Compliance-Auflagen überzogen, die er weder personell noch finanziell stemmen kann – und das in einer Zeit, in der viele Betriebe ohnehin ums wirtschaftliche Überleben kämpfen.“
Richtlinie stärke skrupellose Akteure
Der Senat warnt, dass mangels verlässlicher Transparenz und Kontrollmöglichkeiten ein Rückzug nachhaltiger europäischer Unternehmen aus wichtigen Auslandsmärkten drohe und so das Feld für skrupellosere Akteure – Staaten und Unternehmen, die sich weder an europäische Umwelt- noch Sozialstandards halten und ihre eigenen geopolitischen Interessen durchsetzen – geebnet werde, mit gravierenden Folgen für Wirtschaft, Umwelt und soziale Entwicklung. Anstatt des erhofften moralischen Fortschritts führe die EU-Lieferkettenrichtlinie zu einem ungewollten Kollaps: Frauenrechte würden wieder verstärkt ignoriert werden, Kinderarbeit verlagere sich in schwer kontrollierbare Schattenmärkte. Das Resultat sei ein dramatischer Rückschritt, wirtschaftlich, ökologisch und sozialpolitisch.
„Kosmetik, kein Kurswechsel“
Der im Februar 2025 vorgelegte Vorschlag der EU-Kommission zur sogenannten „Omnibusverordnung“ bleibe laut dem Senat der Wirtschaft weit hinter den Erwartungen zurück. Zwar sollen Unternehmen künftig in erster Linie ihre direkten Geschäftspartner prüfen müssen, doch bei Hinweisen auf schwerwiegende Verstöße bleibt die Pflicht zur Prüfung entlang der gesamten Lieferkette bestehen. „Das ist Kosmetik, kein Kurswechsel“, betont Harrer. „Die strukturelle Überforderung bleibt bestehen. Die Folgen sind verheerend: Soziale und ökologische Standards in Entwicklungs- und Schwellenländern geraten unter Druck, statt gestärkt zu werden.“
Der Senat der Wirtschaft befürchtet, dass aus Sorge vor Haftungsrisiken insbesondere Großunternehmen auch weiterhin umfassende Nachweise einfordern werden – mit erheblichen Auswirkungen auf kleine und mittlere Betriebe. Diese würden sich weiterhin mit hohen bürokratischen und finanziellen Belastungen konfrontiert sehen. Die wenigen Erleichterungen wie etwa verlängerte Fristen würden nichts am Grundproblem ändern: Die politische Verantwortung für globale Herausforderungen würden auf die Wirtschaft abgewälzt werden und insbesondere den Mittelstand überfordern.
„Keinesfalls zu akzeptieren ist, dass skrupellose Staatslenker durch das Abwälzen der Kontrollpflichten auf Unternehmen, ihrer Verantwortung gegenüber Land und Mensch enthoben werden.“ betont Harrer dazu.
Forderungen des Senats der Wirtschaft
Der Senat der Wirtschaft fordert daher eine vollständige Rücknahme der Lieferkettenrichtlinie, keine nationale Übererfüllung von EU-Vorgaben („Gold Plating“) und eine partnerschaftliche Entwicklungspolitik auf Augenhöhe. Außerdem werden in der Aussendung noch ein Bürokratieabbau und gezielte Investitionsanreize für KMU sowie den Ausbau fairer und durchsetzbarer Handelsabkommen – bilateral wie multilateral (z.B. Mercosur) – gefordert.
Forderung nach Vernunft
Der Senat der Wirtschaft räumt zwar ein, dass die EU-Lieferkettenrichtlinie hehre Ziele verfolge, in ihrer jetzigen Ausgestaltung aber Gefahr laufe, wirtschaftlichen Schaden anzurichten, anstatt Menschenrechte und Umweltstandards zu stärken. Globale Standards würden sich nicht durch europäische Alleingänge erzwingen lassen, so der Senat.
„Als Gesellschaft müssen wir Verantwortung tragen“, sagt Harrer. „Wirtschaftliche Verantwortung darf nicht die moralische Pflicht der Politik ersetzen und auf die Unternehmen abgewälzt werden.“ Laut dem Senat würden, nach dem Rückzug europäischer Unternehmen aus schwierigen Märkten, oft Anbieter aus autoritären Staaten übernehmen– mit geringem Interesse an sozialen und ökologischen Standards, aber großem geopolitischen Kalkül.
Harrer warnt daher: „Europa braucht Regeln – aber auch wirtschaftliche Vernunft und Respekt vor der Rolle der Unternehmer. Wer das ethische Fundament unseres Wirtschaftssystems stärken will, darf es nicht mit unrealistischen Anforderungen untergraben.“