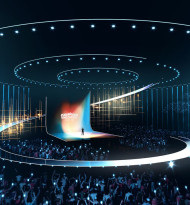••• Von Georg Sohler
Die Welt präsentiert sich im ersten Quartal 2025 nicht unbedingt gemütlich. Russland attackiert weiterhin die Ukraine; ein neuer US-Präsident, der auf Protektionismus setzt und den Sicherheitsfokus in den Pazifik zu verschieben scheint, anhaltende Unruhe im Nahen und Mittleren Osten, Handelskriege, Terror. Auf den ersten Blick gibt es wenig Anlass für einen optimistischen Blick in die Zukunft. Selbst wenn man sich hierzulande in relativer und hoffentlich nicht trügerischer Sicherheit wiegen kann, hat die weite Welt Auswirkungen auf das kleine Österreich.
Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) urteilte Mitte Februar: noch keine Aussicht auf Konjunkturaufhellung. Die weltweite Industrieproduktion und der Welthandel folgen zwar seit Mitte 2023 einem Aufwärtstrend, Importzölle durch die USA und allfällige Gegenreaktionen der betroffenen Handelspartner gefährden aber diese Dynamik. Die rot-weiß-rote Industrie verbuchte im vierten Quartal 2024 Produktionseinbußen, der Export ließ nach. Auch die Inflationsrate erhöhte sich zu Jahresbeginn 2025 wieder deutlich auf voraussichtlich 3,3%, Ende 2024 waren noch Werte von unter zwei Prozent gemessen worden. Der Arbeitsmarkt leidet zunehmend unter der Konjunkturschwäche.
Die Politik, die sich in monatelangen Regierungsbildungsverhandlungen verloren hat, muss ein Budgetloch stopfen und für passende Rahmenbedingungen sorgen. Komplett desillusioniert ist die breite Masse allerdings nicht. Das Weihnachtsgeschäft brachte einen Mehrumsatz und ein preisbereinigtes Wachstum. Die Konsum- und Investitionsnachfrage gestaltet sich lebhafter. Wer durch das Land geht oder fährt, sieht: Skigebiete und Innenstadtlokale sind alles andere als leer. Was stimmt denn nun?
Um das festzustellen, hat medianet Handelsunternehmen kontaktiert und gefragt, wie sie die Lage einschätzen. Denn gegessen wird schließlich täglich, und der LEH würde klar registrieren, wenn nur noch das Billigste verkauft wird. Dann wäre Feuer am Dach. Ganz so ist es nicht.
Frühwarner Handel
„Trotz einer stabilen Entwicklung der Kaufkraft in Österreich hat die anhaltende Inflation das Einkaufsverhalten der Konsumenten beeinflusst”, erklärt Diskonter Hofer auf Anfrage und zeigt die Konsequenzen auf: „Kunden greifen vermehrt zu Aktionen und Preiseinstiegsartikeln sowie ganz allgemein zu unseren Eigenmarken.” Während sich die LEH-Platzhirsche Rewe und Spar nicht äußern wollten, erzählt David Mölk über MPreis aus Tirol Ähnliches wie der Diskonter, mit dem Zusatz, dass es Zuwächse im Hochpreissegment gebe: „Es ist vor allem das Warensegment in der Mitte, welches sich im Rücklauf befindet.”
Das betrifft aber nicht nur den LEH, sondern auch andere Produkte des täglichen Bedarfs. dm erklärt in Person von Harald Bauer, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung: „Menschen wollen sich weiterhin etwas Gutes tun, aber sie werden preissensibler.” Daher boomen die Eigenmarken.
Zurückhaltung registriert auch Fachwarenhändler 3e, auch wenn diese Produkte keine alltäglichen sind. „Die Kunden sind zurückhaltender, die Frequenz verringert, der Durchschnittsumsatz pro Kassabon sinkt”, so CEO Bernhard Reiter.
Gemischte Gefühle
Die Betrachtung des Handelsverbands lautet, dass nach mehreren Jahren mit rückläufigen Real-Umsätzen und einem ebenfalls schwierigen ersten Halbjahr 2024 die Umsätze im Einzelhandel im 2. Halbjahr 2024 erstmals wieder spürbar nach oben gingen – wenn auch von einem niedrigeren Niveau aus. Geschäftsführer Rainer Will sagt: „Nach zwei Jahren Rezession geht es also nur sehr langsam aufwärts. Das Wifo prognostiziert derzeit ein minimales Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. Das Pflänzchen bleibt zart, und viele Risiken bleiben bestehen, etwa durch Donald Trumps Zollpläne.”
Dass die Kaufkraft nach den Lohnerhöhungen der letzten Jahre gestiegen ist, bestreitet der Handelsverband nicht. Aber: „Die Frage ist nur, ob auch die Ausgabebereitschaft der Kunden steigt. Dafür ist die derzeitige volatile Lage nicht förderlich.” Politische Unsicherheiten in Kombination mit einer Wirtschaftskrise und steigender Arbeitslosigkeit führen aus seiner Sicht automatisch zu einem Angstsparen. Eine gemischte Analyse des Handels, die zumindest nahelegt, dass sich die Konsumenten gut überlegen, wann und wo sie Geld ausgeben. Doch Menschen sind nicht nur Kunden. Auch die Sicht der Verbraucher spielt eine Rolle, sind doch sie die Betroffenen, die die Waren des täglichen Gebrauchs kaufen (müssen).
„Komplett unklar”
Antworten auf derartige Fragen aus Konsumentensicht liefert die Arbeiterkammer in Person von Sarah Beran, Ökonomin in der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik. Sie erinnert grundsätzlich daran, dass die zwei Jahre Rezession insbesondere die Industrie treffen. Man befürchtet nun ein drittes Jahr Wirtschaftsflaute. „Zwar werden leichte Impulse aus der Bauwirtschaft und dem Dienstleistungssektor erwartet, doch der private Konsum stagniert bereits seit fast zwei Jahren. Die kollektivvertraglichen Lohnabschlüsse haben die Einkommensverluste der letzten Jahre aufgeholt und das real verfügbare Haushaltseinkommen steigen lassen. Aber es ist aufgrund des fehlenden Plans noch unklar, wie sich die Budgetsanierung auf die Wirtschaft auswirkt.”
Sollte die nächste Regierung diese Konsolidierung über Ausgabenkürzungen geschehen lassen, bestünde aus ihrer Sicht die Gefahr eines dritten Rezessionsjahres, was den Wirtschaftsstandort „erheblich belasten” würde. Allerdings sieht sie die Diskussion über Österreichs Wirtschaft als „zu eng geführt”. Die österreichische Industrie sei seit Jahrzehnten äußerst erfolgreich. Betrachtet man etwa die Produktionsentwicklung, zeigt sich, dass die industrielle Produktion in Österreich seit dem Jahr 2000 um fast 70% gewachsen ist – im Vergleich dazu beträgt das Wachstum in Deutschland lediglich acht Prozent.
Es ist nicht alles gut!
Man stehe also „deutlich besser da, als es in der öffentlichen Debatte häufig dargestellt wird”. Österreich verfüge laut Beran über über ausgebildete Fachkräfte, eine leistungsfähige Infrastruktur, funktionierenden Sozialstaat und hohe Lebensqualität – „Faktoren, die nicht nur Arbeitnehmer anziehen und im Land halten, sondern auch Unternehmen zu Investitionen bewegen.” Dies zeige sich auch in der privaten Investitionsquote, die 2023 mit 21,9% des BIP einen Prozentpunkt über Deutschland und zwei Prozentpunkte über dem Eurozonen-Schnitt lag. Preissteigerungen, hohe Zinsen und eine anhaltende Konsumschwäche würden diese Entwicklungen gefährden, aber so schlecht, wie getan wird, sei man nicht. Was sich ändern muss, sehen die befragten Wirtschaftsvertreter schon sehr ähnlich. Da geht es eben um Fachkräfte, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Entbürokratisierung; da und dort herrscht wohl auch Hoffnung, dass die Arbeitskosten reduziert werden.
Auf den Punkt bringt dies Mölk: „Mit Blick auf die Zukunft ist Planungssicherheit essenziell. Große, langfristige und vor allem nachhaltige Investitionen erfordern verlässliche Rahmenbedingungen ohne überbordende Bürokratie und Regulierungen.” Pointierter formuliert es Will: „Dass die Regierungsverhandlungen so lange dauern, ist auch für den Handel Gift. Alle wichtigen Themen sind weiterhin ungelöst.”
Handlungsbedarf: Ja, aber
Vor allem braucht es zielgerichtete Maßnahmen, wie Beran auch anmerkt. Einerseits beobachtet man nach mauen Jahren wieder steigende Nettolöhne, andererseits „verfolgen wir die Sozialstatistiken von ‚So geht’s uns heute' der Statistik Austria, laut der jeder siebte Erwachsene in den nächsten drei Monaten Zahlungsschwierigkeiten bei Wohn- und Energiekosten erwartet”. Unter Arbeitslosen ist es jede dritte Person, jeder vierte Erwachsene kann sich laut dieser repräsentativen Befragung eine Ausgabe von 1.390 € nicht sofort und alleine leisten
Sprich: Das Bild ist trügerisch bzw. stimmt beides. Wer Geld hat, kann sich das Leben gut leisten, die, die weniger haben, tun sich schwer. Die AK schlägt als Lösung für die Situation Folgendes vor: „Eine nachhaltige Budgetsanierung kann nur durch eine Belebung der Konjunktur gelingen – das bedeutet, dass Konsum, Investitionen und Beschäftigung steigen müssen. Sinnvolle Maßnahmen wären hierbei beispielsweise eine Erhöhung öffentlicher (Klima-)Investitionen sowie eine gezielte Förderung von guter Beschäftigung.”
Starke ausgabenseitige Kürzungen hingegen wären insgesamt riskant, da sie die Rezession verschärfen und verlängern können. Der Forderung nach weniger Bürokratie könnte mit echtem Sparen im System nachgekommen werden. Aber: „Viele Unternehmer haben in den letzten Jahren eine ‚Vollkaskomentalität' entwickelt – sobald es schwierig wird, soll der Steuerzahler die unternehmerischen Risiken tragen”, schreibt Bauer der Wirtschaft ins Stammbuch. Man müsse selbst optimistisch sein und Verantwortung übernehmen, denn: „Im internationalen Vergleich ist Österreich als Wirtschaftsstandort weiterhin sehr wettbewerbsfähig, auch wenn es in einigen Bereichen Herausforderungen gibt.”