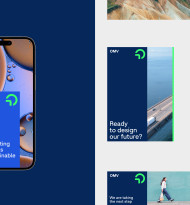Milch und Milchprodukte gehören für viele Menschen zur Ernährung dazu, wie das tägliche Brot. Damit die Produkte auch auf die Tische kommen, dafür sorgen in Österreich 22.000 Milchbauern, rund 5.800 Mitarbeiter in den Molkereien sowie zahlreiche Beschäftigte in Logistik, Handel und anderen Bereichen. Milch kommt nicht nur in Österreich gut an, sondern auch über die Grenzen hinaus: 2024 wurden Milchprodukte um 1,78 Mrd. € exportiert, während um 1,17 Mrd. € importiert wurden.
Viele Anforderungen
Das ergibt einen Überschuss in der Höhe von 613 Mio. €, der zudem höher ausfällt als im Vorjahr. Die Exporte stiegen 2024 um drei Prozent; das wichtigste Produkt ist mit einem Exportwert von 918 Mio. € nach wie vor Käse. Die Importe sind ebenfalls spürbar gestiegen (+3,9%). Der Markt präsentiert sich dabei durchaus herausfordernd, wie der Milchverband Österreich-Geschäftsführer Johann Költringer im Interview mit media-net erklärt.
Warum ist es aber nicht so einfach? Die Herden sind im Vergleich zum Ausland sehr klein. Außerdem erwartet sich die Gesellschaft viel, „man will Tierwohl und Co., ist aber kaum bereit, dafür zu bezahlen.“ Die in Zahlen ablesbare erfolgreiche Performance sichert in der Produktion, Verarbeitung und im Export Arbeitsplätze und hält bzw. generiert Wertschöpfung für das Land. Doch dazu braucht es die entsprechenden Rahmenbedingungen, die zum einen aus Brüssel kommen und zum anderen von der seit einigen Monaten im Amt befindlichen neuen Bundesregierung.
Diese sieht sich mit einer Gesamtwirtschaftslage konfrontiert, die nicht rosig ist; sparen ist angesagt. „Die neue Regierung ist gefordert, eine positive Perspektive und neue Zuversicht zu geben, damit Investitionen und Konsum – und damit die Wirtschaft – wieder in Gang kommen.“
Wettbewerb ermöglichen
Für die Milchwirtschaft sei eine stärkere Fokussierung auf wesentliche Aspekte dabei aus Költringers Sicht notwendig. Für die Wirtschaft sind hierbei insbesondere die bürokratischen Belastungen und Abgaben anzusprechen, die „keinesfalls durch weitere Vorschriften bzw. Belastungen weiter erhöht werden dürfen, sondern reduziert werden müssen. Wir müssen sehen, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten und verbessern können; neue kostentreibende Auflagen oder neue Bürokratie sind zu vermeiden.“
Stabil und hochwertig
Eine Möglichkeit zu unterstützen, wäre eine ehrliche Kennzeichnung der Herkunft, damit der Kunde beim Einkauf eine klare Orientierung über die Herkunft und über die damit verbundenen Qualitätsstandards hat. Generell scheint es der heimischen Milchwirtschaft gut zu gehen. „Sie ist weiterhin ein stabiler und verlässlicher Faktor in unserem Land“, so Költringer. Milch stehe für hochwertige Ernährung, zudem erbringe sie mit dem Erhalt des Grünlandes, der Wiesen und Almen wichtige ökologische Leistungen.
Zusammengefasst: „Die Milchwirtschaft arbeitet mit geringen Margen in einem hochkompetitiven Umfeld, der hohe Außenhandelsanteil zeigt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche.“ Dazu kommen noch unplanbare Umstände, wie die massive Beunruhigung durch Tierseuchen in unmittelbarer Grenznähe zu Österreich. Hier wurden Schutzmaßnahmen gesetzt, vorerst scheint die Gefahrenlage wieder entschärft. Dies zeigte erneut: Tierprodukte stehen nicht nur deshalb unter besonderer Beobachtung.
Genaue Beobachtung
Der österreichischen Milchwirtschaft ist es wichtig, dass es den Kühen gut geht. Wo immer heutzutage Nutztiere gehalten und sie bzw. ihre Produkte weiter verarbeitet werden, schaut die Öffentlichkeit kritisch hin. Költringer meint: „Die gewohnten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards der österreichischen Milchwirtschaft wurden im letzten Jahr mit der Einführung des Programms ‚Tierhaltung plus‘, welches zusätzliche, jährlich kontrollierte Verbesserungen im Tierwohlbereich vorsieht, nochmals erhöht.“
Das ist aber nicht alles, was aus seiner Sicht für Milch spricht: Mit Gentechnikfreiheit, dem Verbot von Soja aus Übersee und ohne Palmöl in der Fütterung, einem guten Raufutteranteil und einer ausgewogenen Zucht werden internationale Maßstäbe der Nachhaltigkeit gesetzt. Das findet auch Anerkennung, so habe die österreichische Milchwirtschaft „gemäß einer Studie des Joint European Research Institute die besten Klimaschutzwerte der Europäischen Union.“
Keine Angst vor Hafer und Co.
Dennoch greifen Konsumenten vermehrt zu Milchalternativen aus Hafer, Soja und Co. Das macht Költringer keine Sorgen, denn Milch enthalte in natürlicher Zusammensetzung – mit hochwertigem Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett, außerdem Mineralien und Vitaminen – alle wichtigen Bausteine einer ausgewogenen Ernährung, „und dies in einer sehr gut verfügbaren Form – ein natürlicher Vorteil, der von Imitaten trotz vielfacher Zusatzstoffe nicht erreicht wird.“ Darüber hinaus stammten Milchprodukte zumeist aus regionaler Produktion.
Im Jahr 2023 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Roh- und Konsummilch, Joghurt und Sauermilchgetränken bei 76 kg. Das bedeutet einen Rückgang von 3 kg im Vergleich zu 2022. Allerdings stieg der Rohmilchverbrauch indirekt über die großen Milchmengen, die zur Herstellung von Butter und Käse benötigt werden, an. Pro Kopf konsumierten die Österreicherinnen und Österreicher 38,6 kg sonstige Milchprodukte. Das entspricht einem Anstieg um 1,3 kg im Vergleich zu 2022. Der Verbrauch von Käse (ohne Schmelzkäse) stieg auf 23,6 kg (+1,1 kg), während der Verbrauch von Obers und Rahm moderat auf 7,9 kg (+0,2 kg) zunahm.
Bio-Europameister
Das liegt im langjährigen Mittel und unterstreicht die Arbeit und die Bemühungen der heimischen Milchwirtschaft. Quasi Europameister ist Österreich in Sachen Bio. Der Anteil liegt in der Produktion bei 18%, damit ist man Spitzenreiter in der EU.
„Zudem gibt es mit Heumilch und anderen, oft regionalen Qualitätsprogrammen in Österreich viele Premiumprojekte.“ Diese Qualitätsschienen wurden zwar primär für den Heimmarkt entwickelt, um die Qualität heimischer Produkte hervorzuheben bzw. zu unterstreichen und abzusichern. Und es wird auch der Großteil in Österreich abgesetzt, aber eben nicht nur. Es ist demzufolge „umso erfreulicher, dass diese Produktqualitäten auch im Ausland sehr beliebt sind“, so der Branchenvertreter.
Import/Export-Fragen
Warum kommen die österreichischen Produkte so gut an? Er meint abschließend: „Allen voran die hohe Qualität heimischer Milchprodukte, besonders unserer Käsespezialitäten, die auch im Ausland im harten Wettbewerb überzeugen, und dies trotz strukturbedingter Kostennachteile.“
Zudem bedient Österreich mit den erwähnten Bio- und Heumilchprogrammen ein Image, mit dem „unsere Kunden im Ausland Positives assoziieren, verbunden mit verlässlichen, höchsten Verarbeitungsstandards. Und nicht zuletzt: Sie schmecken.“ Der Export bleibt auch nach wie vor wichtig, fast die Hälfte der heimischen Milchprodukte wird exportiert, umgekehrt werden ca. 30% importiert.
Ein nach wie vor stabiler Verkauf, mehr Tierwohl, nachvollziehbare Argumente, warum man zu heimischer Milch greifen kann bzw. sollte. Das passiert eben auch, sowohl im In- als auch im Ausland greifen die Konsumenten gerne zu heimischen Molkereiprodukten.

Starker Anstieg bei rechtlicher Beratung für Journalisten
Die Beratungsfälle des Rechtsdiensts Journalismus nehmen zu. Suchten Journalisten von Herbst 2022 bis 2023 noch 66 Mal rechtlichen Rat, war es von Herbst 2024 bis 2025 mit 118 fast