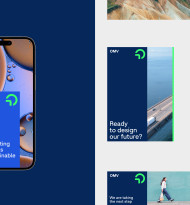••• Von Martin Rümmele
WIEN. Primärversorgungseinheiten (PVE) sind das Kernelement von Reformbemühungen im Gesundheitswesen. Allerdings kam das Programm seit dem Start 2016 bisher nicht wirklich ins Laufen. Bis 2023 sollten es 75 neue Primärversorgungseinheiten sein, tatsächlich sind es erst 39. In Vorarlberg und Tirol gibt es noch gar keine Einheiten. Dabei gibt es aktuell auch eine Fördertopf der EU, der mit 100 Mio. € dotiert ist. Bund, Länder, Krankenkassen und Ärzteschaft geben einander gegenseitig die Schuld für die Probleme.
Bessere Kooperation
In PVE sollen mehrere Allgemeinmediziner zusammenarbeiten; das Angebot soll so breiter werden, die Öffnungszeiten sollen länger sein. Möglich sind Primärversorgungszentren an einem Standort oder Netzwerke, wo mehrere, kleine Ordinationen kooperieren und sich abstimmen. Doch hier liegt eines der Probleme, denn die Stakeholder sind uneinig, was PVE eigentlich sein sollen. Für die Länder sind es primär Entlastungen für Spitalsambulanzen, für die Krankenversicherungen zusätzliche Versorgungsangebote im allgemeinmedizinischen Bereich. Das Ziel der Kassen: längere Öffnungszeiten und Entlastung der dort arbeitenden Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Ein wirkliches Konzept fehlt aber bis heute. Lange Zeit fehlte zudem ein bundesweiter Gesamtvertrag zwischen dem damaligen Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer. „Primärversorgungseinheiten waren im Stellenplan abzubilden – was die Zustimmung der zuständigen Ärztekammer erforderte – und mussten über einen Vertrag mit der ÖGK verfügen”, erklärt der Rechnungshof nun in einem neuen Bericht.
Kritik vom Rechnungshof
Die Prüfer weisen zudem darauf hin, dass insbesondere die Unkündbarkeit der Vertragspartner, „die wirtschaftlichen Risiken im Falle eines Zusammenschlusses und die Zustimmungspflicht der Landesärztekammer (für monetäre Anreize in den gesamtvertraglichen Honorarvereinbarungen) die Einführung der Primärversorgung vor große Herausforderungen stellt”.