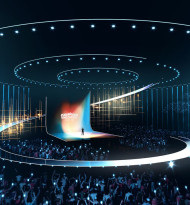Leitartikel ••• Von Sabine Bretschneider
KATZENJAMMER. Wie man mit demokratischen Mitteln die Demokratie abschafft, dürfen wir derzeit in den USA beobachten. Die Strategien sind bekannt und geschichtlich gut erprobt, die Geschwindigkeit darf als Ausreißer gelten. Schwieriger wird die Umkehr dieses an der Wahlurne legitimierten Umsturzes.
Wenn erst einmal alle potenziellen Widerständler aussortiert, die Gewaltenteilung im Land ausgehebelt, die Medien auf Linie gebracht sind, ist die Rückkehr steinig. Insbesondere, wenn jene, die für eine Renovierung zuständig sein werden, nicht dieselben Mittel benutzen wollen. Am einfachsten und zeitsparendsten wäre es, die demokratischen Grundfesten mit Mitteln der Diktatur wieder zu errichten. Aber hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Außerdem: Cui bono? Wer sich in Allmacht räkelt, gibt sie im Regelfall ungern wieder auf. Die kommenden fünf Jahre werden definitiv interessante Zeiten werden.
Was Diktaturen – oder, in modernerer Bezeichnung: Autokratien – mit demokratischen Staatsformen jedenfalls eint, ist die Ausrichtung am vermeintlichen „Gemeinwohl”. Der gravierende Unterschied besteht darin, wer diese Definition vornehmen darf, wie diese Entscheidungsfindung vor sich geht – und welche Mittel und Wege als legitim gelten. Am Thema Korruption: In seiner zweiten Amtszeit als Präsident präsentiert sich Trump als wiedergeborener Kämpfer gegen Korruption, der Verschwendung, Betrug und Missbrauch in allen Bereichen der Verwaltung gnadenlos aufdeckt – während er gleichzeitig die etablierten Mechanismen zur Bekämpfung von Korruption abbaut.
Was zählt, ist die Definitionsmacht. Wer sich allerdings im Wettstreit über die Deutungshoheit im Echokammern-Labyrinth verirrt, rutscht in eigenartige Milieus ab, in entkoppelte Wahrheitssysteme (siehe die Zuweisung der Kriegsschuld an die Ukraine), deren Aufbau zig Milliarden gekostet hat. Den Abriss muss man sich erst einmal leisten können. Und wollen. Es sieht nicht danach aus.