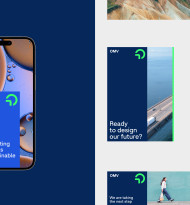WIEN. Der AI Act der EU ist der weltweit erste Rechtsakt, der konkrete Regelungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) enthält. Gemäß der Verordnung müssen Unternehmen seit Februar etwa Mitarbeitende im Umgang mit KI-Systemen schulen. Mit August gelten dann die übrigen Verpflichtungen, beispielsweise eine Transparenzpflicht für generative KI-Systeme.
medianet hat bei Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des Dialog Marketing Verbandes Österreich (DMVÖ), nachgefragt, was heimische Unternehmen nun beachten sollten.
medianet: Frau Vetrovsky-Brychta, der AI Act der EU setzt neue Maßstäbe für die Regulierung von KI. Welche konkreten Auswirkungen erwarten Sie für Unternehmen in Österreich, insbesondere in der Marketing-Branche?
Alexandra Vetrovsky-Brychta: Der AI Act wird sich nicht unbedingt massiv auf die Marketing-Branche auswirken. Wir sind es gewohnt, unsere Anwendungen auf Gesetzeskonformität zu prüfen und der AI Act beinhaltet viele bereits bekannte Vorgehensweisen wie Informations- oder Schulungspflichten. Auch andere Gesetze, wie die DSGVO, werden vom AI Act nicht abgelöst, sondern ergänzt. Dementsprechend gibt es mit dem AI Act einfach ein Gesetz mehr, das in den Compliance-Prozess eingegliedert werden muss.
medianet: Der Einsatz von KI berührt oft sensible Daten. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie Datenschutzbestimmungen einhalten, ohne dabei Innovationspotenziale zu verlieren?
Vetrovsky-Brychta: Ich würde nicht sagen, dass der Einsatz von KI zwingend sensible Daten im Sinne der DSGVO berührt – eher sensible Daten im Sinne der Unternehmensführung. Es ist wichtig, zwischen sensiblen Daten für Unternehmen, etwa Geschäftsgeheimnisse, und sensiblen, personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO zu unterscheiden. Die DSGVO wahrt den Datenschutz und ich sehe keine Innovationshemmung für den Einsatz neuer Technologien.
medianet: Wo sehen Sie die größten ethischen Herausforderungen im Umgang mit KI in der Wirtschaft? Gibt es Anwendungsfälle, die besonders sensibel sind?
Vetrovsky-Brychta: Das Thema Ethik und KI hat so viele Facetten, die hier gar nicht alle aufgezählt werden können. Ein großes Thema aber sind Biases, zum Beispiel der Gender- und Diversity-Bias. Wird die KI aufgefordert, eine ‚CEO Darstellung' zu generieren, erstellt sie automatisch ein Bild eines weißen Mannes. Das verdeutlicht, dass auch die KI nicht von Biases gefeit ist und Ergebnisse kritisch hinterfragt werden sollten. Um die ethischen Standards in der Wirtschaft zu gewährleisten und gleichzeitig Gleichberechtigung und Gleichstellung zu forcieren, müssen in erster Linie menschliche Mitarbeitende im Umgang mit KI geschult werden.
medianet: Der DMVÖ setzt sich für eine verantwortungsvolle Nutzung von KI ein. Was empfehlen Sie Unternehmen, um ethische und regulatorische Risiken zu minimieren?
Vetrovsky-Brychta: Das ist einfach – die Einhaltung der Regulierungsbestimmungen im AI Act und allen anderen geltenden Gesetzen. Macht man eine Risikoeinschätzung, schult man seine Mitarbeiter mit KI-Kompetenztrainings und hält die Transparenzpflichten ein, hat man bereits einen Großteil des Weges geschafft.
medianet: Trotz der Regulierung bietet KI enorme Chancen. Wie können Unternehmen KI nutzen, um sich strategische Wettbewerbsvorteile zu sichern, ohne in rechtliche Grauzonen zu geraten?
Vetrovsky-Brychta: Ich bin keine Juristin und kann daher keine Rechtstipps geben, ich kann allerdings einen allgemeinen Tipp aussprechen: Der erste Schritt sollte immer das Konkretisieren meines gewünschten Mehrwerts und des genauen Anwendungsfalls sein. Man sollte also den Use-Case und das Ziel festlegen, um danach den Zeithorizont und die nötigen Ressourcen bereitstellen zu können. Denn ‚wir machen jetzt was mit KI' oder ‚KI soll überall dabei sein' ist nicht konkret genug, um zu einem langfristigen Erfolg zu führen. Es braucht eine klare Strategie, ein klares Ziel und dafür bereitgestellte Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell – erst dann sollte man sich Gedanken um die Compliance machen. (fej)