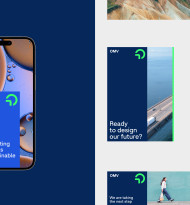medianet: Herr Köhazy, sie sprechen davon, dass die Kommunikationsbranche bezüglich Nachhaltigkeitskommunikation ihre Hausaufgabe nicht gemacht hätte und man, verkürzt gesagt, bei diesem Thema für die breite Masse „schlichtweg die falsche Sprache spricht“, wie sie sagen. Was meinen sie damit?
Andreas Köhazy, Kommunikations- und Marketingstratege, Studio Köhazy: Die Kommunikationsbranche hat beim Thema Nachhaltigkeit einen entscheidenden Fehler gemacht: Sie hat nicht gelernt zuzuhören. Statt die wahren Bedürfnisse und Wünsche der Gesellschaft zu erfassen, wurde oft von oben herab mit akademischen Standpunkten kommuniziert. Das Ergebnis? Eine Kluft zwischen gut gemeinten Botschaften und der Lebensrealität der Menschen.
Die traditionelle Nachhaltigkeitskommunikation richtet sich an die ohnehin schon überzeugten 20% der Bevölkerung. Doch was ist mit dem Rest? Der Großteil der Gesellschaft möchte durchaus nachhaltig leben, aber es muss in den Alltag integrierbar und der Nutzen spürbar sein. Hier liegt der Knackpunkt: Die Sprache muss sich anpassen, ohne jedoch Vorteile wie "klimaneutral" oder Rückverfolgbarkeitshinweise komplett zu verbannen. Diese Elemente sollten nicht verschwinden, sondern als Zusatzantrieb dienen, während der Hauptfokus auf dem konkreten Nutzen liegt.
medianet: Hätten sie ein Beispiel?
Köhazy: Stellen Sie sich Nachhaltigkeitskommunikation wie Tandemfahren vor: Die Nachhaltigkeit sitzt zwar mit am Rad und tritt kräftig in die Pedale, aber am Steuer sitzt der Nutzen. Er gibt die Richtung vor. Konkret heißt das: Kommunizieren Sie, wie Sie das Leben einfacher, schneller oder unterhaltsamer machen. Damit sinkt die Hürde, sich für ökologisch nachhaltige Produkte/ Dienstleistungen zu entscheiden.
Die Branche muss umdenken: Weg von der reinen (primären) Betonung von Klimaneutralität, hin zu vertrauensvoller, unterhaltsamer Kommunikation mit praktischen Informationen und konkreten Handlungsoptionen. Dabei ist es entscheidend, dass wir zunächst zuhören und verstehen, was die Menschen wirklich bewegt. Nur so können wir die breite Masse erreichen und echte Veränderung bewirken, ohne den wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren.
Ich sage nicht, dass alles bisherige schlecht war - es braucht ein diverses Spektrum an Kommunikationsstrategien und der Aufschwung der Klimabewegung 2019 hat gezeigt, wie wichtig es ist, Bewusstsein dafür zu schaffen.
medianet: Sie sagen auch, dass vor allem technische Begriffe aber auch Dinge wie ESG-Berichte für die breite Masse eher weniger geeignet sind?
Köhazy: Während in der Politik heute munter gelogen und übertrieben wird, steht die Kommunikationsbranche vor der Herausforderung, einen Wahrheitsanspruch zu bewahren und gleichzeitig Greenwashing zu vermeiden. Nachhaltigkeitsberichte, Impact-Messung und Lieferkettenrückverfolgbarkeit sind zweifellos wichtige Errungenschaften der letzten Jahre. Doch diese Informationen sprechen primär eine spezifische, interessierte Zielgruppe an und dienen als Gegencheck/ Verifizierung.
Die Crux liegt darin, dass Nachhaltigkeitsberichte oft dazu dienen, zu zeigen, dass ein Unternehmen "eh nichts Schlechtes" macht. Für skeptische Verbraucherinnen und Verbraucher sind sie eine wertvolle Ressource. Aber die Mehrheit der Gesellschaft interessiert sich nicht für diese technischen Details.
Was wir stattdessen brauchen, ist eine einfache, verständliche Sprache, die frei von Ideologien ist. Begriffe wie "Transformation" oder ein ideologisch-generischer "Wandel" verfehlen die Mitte der Gesellschaft. Es geht darum, konkrete Vorteile und greifbare Lösungen zu kommunizieren, die im Alltag der Menschen ankommen.
medianet: In der Kommunikation ist hier oft von Verzicht, Einschränkungen und Mehrkosten die Rede. Müsste man nicht mehr den Schaden in den Vordergrund stellen, der eintritt, wenn man nichts etwa im Klimaschutz unternimmt, sprich, welche Themen müsste man in den Vordergrund stellen?
Köhazy: Die Kommunikation über Klimaschutz hat sich lange Zeit auf Verzicht, Einschränkungen und Mehrkosten fokussiert. Und klar, für etwa 20% der Gesellschaft mag dieser Ansatz funktionieren, aber für die breite Masse ist er wenig intrinsisch motivierend. Selbstverständlich sollten wir in den Parlamenten dieser Welt die potenziellen Schäden und Kosten des Klimawandels diskutieren, um langfristig Klimakatastrophen, Leid und finanzielle Belastungen zu vermeiden - doch als Motivationsinstrument für den gesellschaftlichen Wandel haben wir mit dieser Strategie meiner Meinung nach einen Zenit erreicht.
Die Berichterstattung über klimabedingte Naturkatastrophen ist zwar essentiell und darf nicht in den Hintergrund geraten, aber sie erzeugt oft ein lähmendes Ohnmachtsgefühl. Brennende Wälder in Kalifornien, vermehrte Hurricanes und
selbst das Hochwasser in Österreich – diese Szenarien sind für viele Menschen schlichtweg zu groß und als Handlungsaufforderung nicht greifbar.
Stattdessen sollten wir uns auf nutzenbasierte Mehrwertkommunikation konzentrieren. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist es viel effektiver, den konkreten Nutzen von klimafreundlichem Handeln aufzuzeigen. Beispiele dafür gibt es viele: Wenn ich statt einzukaufen Lebensmittel günstiger "retten" kann, oder wenn ich durch energieeffiziente Geräte meine Stromrechnung senken kann.
medianet: Wofür plädieren sie hier in der Kommunikation?
Köhazy: Letztendlich müssen wir Klimaschutz als Chance für ein besseres Leben kommunizieren, nicht als notwendiges Übel. Nur so können wir die breite Masse erreichen und echte Veränderung bewirken.
Beispiele:
Wenn ich statt einzukaufen, Lebensmittel günstiger vor der Verschwendung retten kann, spare ich nicht nur Geld, sondern reduziere auch Lebensmittelverschwendung. Apps wie "Too Good To Go" machen dies einfach und zugänglich.
Wenn ich statt eines Neukaufs auf günstigere Refurbished-Produkte setze, verlängere ich die Lebensdauer von Geräten und spare langfristig Geld.
Wenn ich statt mit dem Auto zu fahren, mein Fahrrad (oder gerne auch E-Bike) für kurze Strecken nutze, spare ich nicht nur Spritkosten, sondern halte mich auch fit und umgehe Staus in der Stadt.
medianet: Bei der Themenauswahl geht es oft um Dinge, die eher im urbanen Raum lebende Menschen betreffen. Wird die ländliche Zielgruppe in der Nachhaltigkeitskommunikation übersehen?
Köhazy: Ja, definitiv. Die ländliche Zielgruppe wird in der Nachhaltigkeitskommunikation oft übersehen. Diese Gruppe ist besonders relevant, weil sie als Brückenbauer fungiert und maßgeblich definiert, was als "normal" gilt. Ohne ihre Akzeptanz können zentrale Veränderungen wie der Umstieg auf Wärmepumpen oder E-Mobilität nicht gelingen. Sie stehen dem Wandel zwar grundsätzlich offen gegenüber, fühlen sich aber oft überfordert: Modernisierungen sind im Alltag schwer umsetzbar, die Infrastruktur hinkt hinterher, und finanzielle Belastungen wie Hauskredite erschweren zusätzliche Investitionen. Am Land funktioniert Meinungsbildung anders als in der Stadt. Während in urbanen Gebieten digitale Kommunikation dominiert, sind es am Land die innergemeinschaftlichen Communities wie Vereine, in denen Verhaltenswandel stattfindet. Die freiwillige Feuerwehr, der Alpenverein, die Landjugend oder die Blasmusik - hier entsteht Ideentransfer und Diskussionen über existierende Lösungen.
Die adaptiv-pragmatische Mitte ist die junge, moderne, digitale Mitte der Gesellschaft. Sie zeichnet sich durch Lebenspragmatismus, Nützlichkeitsdenken sowie eine ausgeprägte Leistungs- und Anpassungsbereitschaft aus. Gleichzeitig legen sie Wert auf Spaß, Komfort und Unterhaltung. Diese Gruppe lebt oft am Land, ist aber auch digital gut vernetzt. Sie tauscht sich in der Gemeinde aus, was in Städten weniger passiert. Als eines der am schnellsten wachsenden Zukunftsmilieus können diese flexiblen Pragmatiker gesellschaftliche Trends setzen. Eine zielgerichtete Nachhaltigkeitskommunikation muss daher ihre spezifischen Bedürfnisse und Lebensrealitäten stärker in den Fokus rücken.
medianet: Sie sprechen auch vom so genannten Garten-Zaun Marketing im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitskommunikation. Was meinen Sie damit und welchen Nutzen soll es bringen?
Köhazy: Gartenzaun Marketing ist ein Begriff, der die Macht des Social Proof (soziale Beeinflussung/ soziale Bestätigung) beschreibt. In urbanen Gebieten, wie in Wien, wo ich aufgewachsen bin und in einer kleinen Wohnung lebe, ist der Austausch mit den Nachbarn oft auf ein Minimum reduziert. Wenn meine Nachbarin eine Lösung wie ein E-Lastenrad nutzen würde, würde ich das wahrscheinlich gar nicht bemerken.
medianet: Und am Land?
Köhazy: Am Land ist das anders. Soll heißen, wenn die Nachbarsfamilie beginnt, ihre Kinder mit dem E-Lastenrad in den Kindergarten zu bringen und nach einiger Zeit nur noch ein Auto statt zwei in der Einfahrt steht, entsteht ein kraftvoller Social Proof. Diese sichtbaren Veränderungen prägen neue Normalitäten und inspirieren zum Nachahmen.
Natürlich gibt es auch einen digitalen Gartenzaun: Facebook, Instagram, TikTok & Co ermöglichen den Austausch von Lebenswelten und beschleunigen Trends. Doch am echten Gartenzaun entsteht eine Dynamik, die (noch) keine Algorithmen kopieren. Hier treffen Blicke aufeinander, entstehen Dialoge, werden Erfahrungen geteilt. Der physische Austausch schafft eine Unmittelbarkeit und Authentizität, die digitale Kanäle nicht erreichen.
medianet: Eine Frage zur aktuellen politischen Entwicklung. Womöglich fallen hier künftig etliche Förderungen im Klimaschutz weg. Wie würden sie kommunikationstechnisch hier reagieren?
Köhazy: Die aktuelle politische Entwicklung, bei der Förderungen im Klimaschutz möglicherweise wegfallen, stellt eine Herausforderung für die Kommunikation dar. Das stufe ich als sehr bedenklich ein. Eine große Mehrheit wendet sich von der bedrückenden Faktenlage ab und sucht nach Geschichten, die besser klingen. Der öffentliche Diskurs wird zunehmend von ungenauen oder falschen Aussagen dominiert, und es wird zunehmend schwieriger zu unterscheiden, was stimmt und was nicht. Das führt dazu, dass einfach das gewählt wird, was besser klingt. Das ist der Weg, den wir nun gehen müssen: Geschichten erzählen - aber mit Wahrheitsanspruch. Es braucht Lösungen, die verschiedene Ideologien zusammenbringen, um die gesellschaftliche Spaltung in eine gemeinsame Richtung zu lenken.
medianet: Und wie könnte so eine Lösung aussehen?
Köhazy:Die Kommunikation muss sich auf positive Zukunftsvisionen konzentrieren. Anstatt nur auf die Kürzungen zu fokussieren, sollte man aufzeigen, welche Lösungen und Möglichkeiten es trotz der finanziellen Einschränkungen gibt. Geschichten, die wahrheitsgetreu sind und die Menschen inspirieren, sind entscheidend. Diese Geschichten sollten nicht nur auf Fakten basieren, sondern auch Emotionen ansprechen und die Werte der Zielgruppe berücksichtigen. Die gesellschaftliche Spaltung kann durch Lösungen, die verschiedene Ideologien überbrücken, gemildert werden. Kommunikation sollte darauf abzielen, gemeinsame Interessen und Werte zu finden, die über politische Grenzen hinweg gelten. Beispielsweise kann der Nutzen von nachhaltigen Maßnahmen für die Wirtschaft, die Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt betont werden.
medianet: Wie muss denn diese Art der Kommunikation gestaltet sein?
Köhazy: Die Kommunikation muss ehrlich und auf Augenhöhe erfolgen. Menschen wollen das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Es ist wichtig, die Herausforderungen anzuerkennen, aber auch konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen, die für die Zielgruppe machbar und relevant sind. Der praktische Nutzen von Nachhaltigkeitsmaßnahmen sollte im Vordergrund stehen. Menschen sind eher bereit, sich für Maßnahmen zu engagieren, wenn sie den direkten Nutzen für ihren Alltag erkennen.
medianet: Kommen wir zu einem aktuellen Thema: Wie bewerten Sie generell die Kürzungen bei Klimaförderungen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen und Konsumenten?
Köhazy: Als Kommunikationsexperte könnte ich nur mutmaßen - die makroökonomische Bewertung überlasse ich Ökonomen.
Für Unternehmen bedeutet dies einen Wegfall finanzieller Anreize für klimafreundliche Investitionen. Konsument:innen werden möglicherweise mit höheren Preisen konfrontiert, was die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten senken könnte.
medianet: Welche Rolle spielen positive Zukunftsvisionen für die Motivation für die Menschen?
Köhazy: Positive Zukunftsvisionen spielen eine entscheidende Rolle für die Motivation der Menschen. Wir müssen weg von einer reinen Verbotskultur hin zu einer Vorbildkultur wechseln. Unsere Gesellschaft ist aktuell sehr problemorientiert und vergisst dabei zu oft, bereits existierende Lösungen zu betrachten.
Was wir brauchen, ist eine "ja und"- statt einer “ja, aber”-Kultur. Statt nur Probleme zu sehen, sollten wir kreative Lösungen entwickeln und zeigen, was bereits heute möglich ist. Das Beispiel der Marktgemeinde Ernstbrunn zeigt genau das: Durch die Verknüpfung von Bedarfsverkehr und belebten Ortskernen kann eine komplexe Alltagssituation - wie das Pendeln mit Kindern, Einkaufen und Familienbesuchen - deutlich vereinfacht werden.
Der Schlüssel liegt darin, praktische und attraktive Alternativen zu entwickeln. Wenn Menschen sehen, dass nachhaltige Lösungen ihr Leben tatsächlich verbessern - sei es durch einen Bürgerinnenbus, Fahrradfreundliche Infrastruktur oder vernetzte Mobilitätskonzepte - dann sind sie motiviert, diese auch anzunehmen.
medianet: Wo sehen Sie aktuell die größten Innovationspotenziale im Green Marketing?
Köhazy: Zusammengefasst, die größten Innovationspotenziale im Green Marketing sehe ich in einer stark nutzerzentrierten Kommunikationsstrategie. Es geht darum, Nachhaltigkeit komplett neu zu denken und beginnen zu erzählen - weg von akademischen Floskeln, hin zu einer Sprache, die Menschen wirklich berührt oder erheitert. Statt Ideologien zu predigen, müssen wir Geschichten erzählen, die Spaß machen, einen konkreten Nutzen versprechen und damit intrinsische Motivation zu wecken. ESG-Reports müssen dabei eine Transparenz- und Bestätigungswirkung erzielen.
Marketingabteilungen müssen innerhalb der Unternehmen aktiv eine Vorreiterrolle übernehmen statt auf Nachhaltigkeitsabteilungen zu warten und dabei mutig neue Narrative entwickeln. Weg von "öko", "grün" und "nachhaltig" - hin zu Botschaften, die zeigen: Unsere Produkte/ Dienstleistungen machen das Leben einfacher, schneller und unterhaltsamer.
medianet: Was braucht es noch?
Köhazy: Am Ende braucht es wohl eine Bereitschaft, Margen zu reduzieren statt Kosten weiterzugeben. Im Idealfall werden sie mit höheren Absatzvolumen belohnt und positionieren sich als wettbewerbsfähige Marke. Der entscheidende Erfolgsfaktor bleibt: Zuhören. Wer die wahren Bedürfnisse versteht, kann authentische Nachhaltigkeitskommunikation entwickeln. (fej/mab)