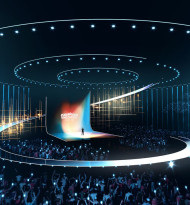••• Von Martin Rümmele und Katrin Grabner
Wenn einem Straßenbahnfahrer oder Lokomotivführer ein schwerer Unfall passiere, bei dem jemand verletzt oder gar getötet werde, bekomme er nicht nur sofort verpflichtende therapeutische Unterstützung, er werde auch selbstverständlich sofort aus dem Verkehr gezogen, erzählt die Herzchirurgin und Vizepräsidentin der Kärntner Ärztekammer, Petra Preiss. „Bei uns ist es vollkommen normal, dass man nach einem Todesfall aus dem Operationssaal geht, einen Kaffee trinkt und dann den nächsten Patienten operiert.”
Es gebe keine Ablösung im Dienst, man mache weiter. „Wenn man Glück hat, kommt der Chef rein oder ein guter Kollege und gibt einem kurz Zuspruch. Man sagt sich, ich habe das Beste gegeben. Das befähigt mich, eine halbe Stunde später in den nächsten Menschen hineinzuschneiden.” Burnout-Fälle gibt es viele, erzählt Preiss: „Man hört viel, es wird aber nicht darüber geredet. Es sind halt längere Krankheitsfälle.” Ihr Fazit im medianet-Gespräch: „Das ist ein entsetzlicher Zustand, den wir haben.”
Hilfe nach Traumata
Das Thema ist in der Fachwelt durchaus bekannt und hat auch einen Namen: „Second Victim”. Der Begriff beschreibt eine an der Patientenversorgung beteiligte Person, die durch eine außergewöhnliche Situation in der Versorgung, bei der es zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall kommt, selbst traumatisiert wird. Wenn das Erlebte nicht aufgearbeitet wird, kann die betroffene Person psychische und physische Krankheitssymptome entwickeln, die zu Arbeitseinschränkungen, Krankenständen und folglich zum Berufsausstieg führen können, erklärt die Anästhesistin und Intensivmedizinerin Eva Potura, Vorsitzende und Gründerin des Vereins Second Victim in Österreich. Wirklich angekommen in der Praxis ist das Thema noch nicht.
Eine neue Studie der Medizinischen Universität Wien liefert Zahlen zum Phänomen und sorgt für Aufregung in der Ärzteschaft: Die im British Medical Journal veröffentlichte Metaanalyse der MedUni Wien zeigt, dass die Suizidrate unter Ärzten und vor allem Ärztinnen schockierend weit über jener der Allgemeinbevölkerung liegt. Genauer gesagt zeigen Daten aus 20 Ländern und 39 Studien, dass das Suizidrisiko für Ärztinnen ganze 76% über jenem der Allgemeinbevölkerung liegt. Jenes der Ärzte war übrigens kaum erhöht, schreiben die Studienleiterin Eva Schernhammer, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der MedUni Wien, und ihre Kollegin und Erstautorin Claudia Zimmermann.
„Alarmierende Zahlen”
Die Ärztekammer Wien spricht dazu von „alarmierenden Zahlen”. „Wir können nicht hinnehmen, dass Ärztinnen im Vergleich zur Allgemeinheit einem derart hohen Suizidrisiko ausgesetzt sind”, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Wiener und Österreichischen Ärztekammer.
„Wir wissen aus eigenen repräsentativen Erhebungen aus dem Spitalsbereich, dass sowohl körperliche als auch emotionale Erschöpfung stark zunehmen und ein großes Problem darstellen. Hinzu kommt auch die erschreckende Erkenntnis, dass sich viele allein gelassen fühlen und das Personal aufgrund der bereits bestehenden Lücken in vielen Bereichen unter hohem Zeitdruck mit reduzierter Manpower arbeiten muss”, sagt Natalja Haninger-Vacariu, Vizepräsidentin und Kurienobfrau des angestellten Bereichs der Ärztekammer für Wien. Sie ist überzeugt, dass nur durch Personalaufstockung, bessere Infrastruktur, gelebte Delegierbarkeit von nicht-ärztlichen Tätigkeiten, geregelte Ausbildungszeiten und Ausbildungsbedingungen sowie mehr Wertschätzung eine Veränderung erfolgen kann.
Auch für Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Obfrau der Kurie des niedergelassenen Bereichs der Ärztekammer für Wien, sind die Studienergebnisse erschreckend. „Die Zahlen zeigen, unter welchem massiven Druck unsere Kolleginnen und Kollegen stehen”, meinte Kamaleyan-Schmied. „Die Arbeitsbedingungen sind aufgrund der jahrelangen Unterfinanzierung des Gesundheitssystems unzumutbar geworden: Massiver Zeitdruck, der Zwang zu Fließbandmedizin sowie eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen durch Personalmangel, fehlende Medikamente und enormen Bürokratieaufwand. Dies alles kann zu Frustration, Erschöpfung, Depression und im schlimmsten Fall zu Suizid führen.”
Ärzte und Ärztinnen würden sich für den Beruf entscheiden, um Menschen zu helfen. „Die Mängel im System gleichen sie durch Eigen-engagement aus und arbeiten bis zur Selbstaufopferung. Ein krankes System macht krankt”, betonte Kamaleyan-Schmied.
Nicht nur die Ärztekammer, auch das Forschungsteam der Studie der MedUni Wien fordert weitere Anstrengungen bei der Erforschung und Verhütung des ärztlichen Suizides – insbesondere bei Ärztinnen.
Ungehörte Hilferufe
„Es war schon schockierend für mich, das Schwarz auf Weiß zu lesen. Aber überrascht hat es mich nicht”, sagt Mireille Ngosso, Spitalsärztin und Wiener Landtagsabgeordnete (SPÖ). „Gerade im Krankenhaus ist man einer sehr großen Belastung ausgesetzt während der Arbeit. Als Ärztinnen und Ärzte sind wir für die Bevölkerung da, aber auf uns selbst schaut niemand. Was in der Psychotherapie und Psychiatrie normal ist, nämlich dass man Supervision und regelmäßig Unterstützung bekommt, gibt es bei anderen Fachrichtungen so nicht. In keiner Spitalsabteilung, in der ich war, wurde auf die mentale Gesundheit des medizinischen Personals geachtet – egal, mit welchen Diagnosen oder Schicksalen man konfrontiert war. Die Arbeit bedrückt, aber es gibt nichts, wo du hingehen, dich aussprechen kannst.” Der schlimmste Fall sei für sie, erzählt Ngosso, jener der Hausärztin Lisa Maria Kellermayr gewesen, die von Impfgegnern bedroht worden ist. „Sie hat um Hilfe gerufen und es ist einfach nichts passiert.”
Von Ärztinnen und Ärzten werde – in Zusammenarbeit mit der Pflege – erwartet, dass sie den Betrieb am Laufen halten. „Die Leute haben deshalb weder die Zeit noch die Kraft, darauf zu schauen, wie es den Einzelnen geht. Die nächste Generation ist die erste, die hier Stopp sagt und verlangt, dass mehr auf die mentale Gesundheit geachtet wird. Da ist sehr viel mehr Bewusstsein da als in den älteren Generationen.”
Druck wächst
Der Weg ist aber noch weit – auch im niedergelassenen Bereich. Der Verein Second Victim hat vor einem Jahr eine Umfrage unter Kinder- und Jugendärzten gemacht. Dort gaben 89% der befragten Pädiater an, zumindest einmal im Berufsleben mit einem traumatisierenden Erlebnis konfrontiert gewesen zu sein, zwei von drei Ärzten sogar mehrfach. Aggressive Patienten oder Angehörige sowie ein unerwarteter Todesfall waren die am häufigsten genannten belastenden Ereignisse. Am meisten wünschen sich Betroffene – neben einer Rechtsberatung –, niederschwellig mit einem Kollegen oder einer Kollegin sprechen zu können.
„Wir appellieren an alle Kolleginnen und Kollegen, die unter psychischen Belastungen leiden, sich Unterstützung zu holen. Rasch und unbürokratische Hilfe erhalten Ärztinnen und Ärzte über die Beratungsstelle Physicians Help Physicians des Referats für psychosoziale, psychosomatische und psychotherapeutische Medizin der Ärztekammer für Wien”, fügt Kamaleyan-Schmied hinzu. Die Beratungsstelle gibt es seit 2020 und wird laut Angaben der Wiener Ärztekammer „gut an- und regelmäßig in Anspruch genommen”. Für Petra Preiss ist das aber noch zu wenig. Denn nicht selten werde der Gang zur Betreuung von Kollegen als Schwäche ausgelegt. „Wer Hilfe braucht, das sind die anderen”, sei nicht selten die Meinung. „Es müsste verpflichtend sein und ein Prozess, den man durchlaufen muss, nach einem traumatischen Ereignis.” Eben wie beim Lokführer.