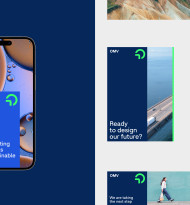Leitartikel ••• Von Sabine Bretschneider
FEHLEINSCHÄTZUNG. Die Jungen sind doch keine „Digital Natives”, durfte man jetzt lesen. In Österreich fehlen über einem Drittel der Schülerinnen und Schüler der achten Schulstufe die absoluten Basics im Umgang mit Computer und Internet.
Nun, wirkliches Wunder ist es keines. Die Usability, die Benutzerfreundlichkeit, moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass tiefergehende Kenntnisse, insbesondere im Privatbereich, nicht mehr notwendig sind. Klicken, wischen und shoppen ist so einfach wie irgend möglich geworden. Darauf beruhen riesige Wirtschaftsbereiche.
Kurz: Diese Fähigkeiten beschreiben noch keine „digitalen Kompetenzen”. Problematisch wird es beim Übergang ins Berufsleben. Beim Bedienen eines Desktop-PCs ohne Touch-Funktion, bei den Funktionen von Officeprogrammen, die über das Öffnen eines Dokuments und das Befüllen mit Content hinausgehen, bei der Einschätzung halbwegs seriöser Quellen, auch bei der beruflichen E-Mail-Etikette. Computational Thinking, ebenfalls in der Studie getestet, bedeutet eben nicht, die Algorithmen der Sozialen Medien zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Allerdings sind Schuldzuweisungen an „die Jungen” fehl am Platz. Das Problem liegt eher aufseiten der Fortbildung des Lehrpersonals der Generationen X und Y, die weitgehend – und ausbildungskonform – nach den Richtlinien der Babyboomer unterrichten. Und selbst jene sind weitgehend unschuldig. Die Aufgaben, die inzwischen an die Lehrenden ausgelagert werden, sind längst zu umfangreich, um noch bewältigt werden zu können.
Fazit: Weder Gen Z noch Gen Alpha sind Work-Life-Balance-fixiert, noch haben sie wie auch immer geartete Kompetenzen mit der Muttermilch aufgesogen. Sie sind wie alle anderen: Sie hätten gern ein Leben neben der Arbeit und zermartern sich selten freiwillig das Gehirn mit exotischen Spezialkenntnissen, wenn es auch einfacher geht. Menschen halt.