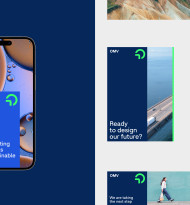••• Von Maren Häußermann
Andere betreten einen Laden und freuen sich über die Fünf-Euro-Jeans. Belinda Winkler betritt den Laden und ihr wird schlecht. Die 26-Jährige designt und produziert selbst Kleidung und weiß deshalb, welch harte Arbeit dahintersteckt. Und dass der niedrige Preis in den Läden die Kosten für die Herstellung niemals decken kann. Sie ist frustriert darüber, dass vielen Konsumenten Kleidung nichts wert ist, weil sie nicht wissen, was das eigentlich ist, Kleidung. Belinda studiert an der Kunstuniversität Linz in Österreich im Studiengang „Fashion and Technology”, den es erst seit fünf Jahren gibt. Motiviert durch die Kritik an der Textilindustrie, forscht man hier an nachhaltigen Alternativen. Die klassische Modedesign-Ausbildung, ergänzt mit Techniken wie Robotik, 3D-Druck, Biomaterialien oder Simulationstechnologien, gibt es im deutschsprachigen Raum noch selten.
Die Studierenden müssen analysieren, wie Mode aktuell funktioniert, und einen Punkt finden, an dem sie ansetzen können, um etwas zu verändern. Aktuell ist Mode vor allem schnell. Fast Fashion heißt dieses Geschäftsmodell. Grundsätzlich gibt es zwei Kollektionen im Jahr: Frühling/Sommer und Herbst/Winter.
Aber Textilgiganten wie die spanische Firma Inditex, zu der Zara, Bershka, Pull&Bear und weitere Marken gehören, führen alle zwei Wochen neue Kleidungsstücke ein. Neue Formen, neue Farben, kaum neue Designs. Aber die alte Ware muss raus: Schlussverkauf, Rabatt. Fast Fashion lebt davon, dass wir kaufen, kaufen, kaufen und dazu bereit sind, Kleidung wegzuwerfen, ohne mit der Wimper zu zucken. Dass wir dem Produkt in unseren Händen nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als einem Orangennetz und seine Herstellung nicht hinterfragen.
Modeherstellung vereinfacht
Ein Textil entsteht durch das Aufspulen von Garn, aus dem anschließend ein Stoff gewebt oder gestrickt wird. Ein Kleidungsstück entsteht durch den Zuschnitt dieses Stoffs nach Designmustern und dem Zusammennähen dieser Schnittteile. „Wenn du ein Stück Stoff in der Hand hast, checkst du im ersten Moment ja gar nicht, dass das voll viele Fäden sind, die miteinander verkreuzt wurden”, sagt Belinda. „Ich wollte diesen Prozess sichtbar machen.”
Gemeinsam mit einem Mechatroniker entwickelte sie eine Maschine, die das Garn kreuzförmig auf eine 1,20 m große Rolle spult. Was sie anschließend von dem zylindrischen Körper abzieht, ist eine Stoffröhre, die je nach Garnmaterial andere Dimensionen annimmt. Glattes Garn ergibt einen losen, feinen Stoff, elastisches Garn ist kompakt. Die Fäden sind dabei gut zu erkennen. Röcke, Tops, Kleider und Hütte hat Belinda so schon hergestellt.
Hier könnte man nun ansetzen, den Spulkörper austauschen, um andere Formen zu wickeln und gegebenenfalls einen Roboter entwickeln, der um einen organischen Körper herumspult. Mit dem ersten Arbeitsschritt im Produktionsprozess könnte man ein ganzes Kleidungsstück kreieren, ohne dabei auf Billigarbeitskräfte in fernen Ländern zurückgreifen zu müssen.
Fast Fashion als Problem
Am Morgen des 24. April 2013 stürzt ein Fabriksgebäude nahe Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, ein. 1.135 Menschen verlieren an diesem Tag ihr Leben. Es sind Textilarbeiterinnen, die von den Fabrikbetreibern zur Arbeit gezwungen wurden, obwohl die Polizei den Zutritt in das marode Gebäude untersagt hatte. Es war weder das erste noch das letzte Mal, dass sich die internationale Aufmerksamkeit auf die Produktionsbedingungen in Billiglohnländern richtete.
Immer wieder gibt es Berichte über Frauen, die ihre Kinder weggeben müssen, weil sie den ganzen Tag arbeiten und dafür kaum Geld bekommen. Die sich wünschen, ein ganzes Kleidungsstück nähen zu können, weil sie, obwohl sie nichts anderes machen, als dieses Kleidungsstück zu produzieren, daran immer nur einen Teil bearbeiten. Einen Reißverschluss anbringen oder eine Naht nähen, wie am Fließband. Und Geschichten von Krankheiten, die auf die Arbeit mit Chemikalien und deren unsachgemäße Entsorgung zurückzuführen sind. Denn die Textilindustrie des 21. Jahrhunderts ist bis jetzt großteils menschenverachtend und weiterhin extrem schädlich für die Umwelt.
Der Fall Bangladesch indes setzte die Fast Fashion-Riesen unter Druck. Sie änderten ihr Marketing, entwickelten Nachhaltigkeitsstrategien und versprachen Transparenz. Im Onlineshop von H&M kann man nun lesen, wo das Produkt gefertigt wurde und wie viele Menschen dort angestellt sind, sei es in Bangladesch, China, Vietnam, Indonesien. Daneben können die Kunden erfahren, woraus ihre Kleidung besteht: Erdöl, Baumwolle, recycelte PET-Flaschen. Was ist nachhaltig?
Innovative Ideen
Auf Fachmessen wie Neonyt oder Innatex in Deutschland treffen sich auch kleinere Modedesigner, Markenvertreter und Einkäufer wegen dieser Frage. Sie präsentieren und sichten Produkte und tauschen sich aus. Man verwendet Naturfasern: Leinen, Bio-Baumwolle, die, so heißt es, bis zu 91% weniger Wasser braucht als herkömmliche Baumwolle und Lyocell/Tencel, das aus Zellulosefasern aus pflanzlichen Zellwänden besteht und biologisch abbaubar ist. Auch Viskose und dessen etwas weichere Version Modal bestehen aus Zellulose. Die Stoffe sollen Polyester, Acryl und Nylon ersetzen, sind aber selbst noch immer synthetisch.
„Produkte herzustellen, die komplett nachhaltig sind, ist wahnsinnig schwer”, sagt Ute Ploier, die die Forschung in Linz leitet. „Es geht darum, eine Balance zu finden, zwischen den Faktoren, die Nachhaltigkeit ausmachen und einen Unterschied machen können.” Selbst Recycling ist für sie keine Lösung, denn der Abfall wird dadurch nicht weniger und die Umweltverschmutzung nicht reduziert. „Und: Es ist einfacher, eine Plastikflasche aus dem Wasser zu fischen, als die Plastikpartikel, die in der Kleidung stecken.” Von ihren Studierenden erwartet sie innovativere Ideen, die von Gräsern bis Keramik, über getrocknete Bananenschalen, Fruchtleder, Eis, Blätter und Bakterien reichen können. Alles ist möglich, solange man daraus ein Kleidungsstück formen kann. Das Design rückt in den Hintergrund, die Mode der Zukunft hängt immer mehr auch von interdisziplinärer Zusammenarbeit ab – der 24-jährige Student Simon Hochleitner findet gerade das spannend.
Er arbeitet mit Softwareprogrammen für Architektur, Produkt- und Gamedesign. Alles begann damit, dass er ein zweidimensionales Schnittmuster am Computer zusammengenäht und an einem 3D-Scan seines eigenen Körpers drapiert hat – der übliche Schneidereiprozess in digital also. Dann wollte er herausfinden, ob der Prozess auch rückwärts funktioniert. Im Digitalen einen dreidimensionalen Körper in einen zweidimensionalen Schnitt dekonstruieren, um so ohne Materialverlust und Abfall maßzuschneidern. Er entwickelte seinen eigenen Code und stellte fest, dass die vom Körper abgeleiteten Schnittmuster, die der Computer ausspuckt, nie symmetrisch sind. „Weil unsere Körper nicht symmetrisch sind”, sagt er.
Kleidung verstehen lernen
Als moderne Modeentwickler arbeiten Simon und Belinda an der Zukunft und bewegen sich gleichzeitig in der Vergangenheit, als Coco Chanel das Korsett wegließ, um dem Körper Platz für Bewegung einzuräumen und sich Schneider an den Vorstellungen der Kunden orientierten. Ihre Bedürfnisse sollen wieder Teil der Designentwicklung werden. Sie sollen in den Prozess eingebunden werden und dabei auch wieder verstehen, was Kleidung eigentlich ist.
Die Kosten- und Preisunterschiede hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Lohnniveau in den Produktionsländern. Dafür fallen Transport- und Lagerkosten weg, was die Produkte erschwinglich macht. Eine Unterhose kostet dann 20 €, ein T-Shirt 50 € und ein Pullover 100 €. Für ihren Erfolg müssen die Kunden nur fähig dazu sein, nicht das Allerbilligste zu kaufen.