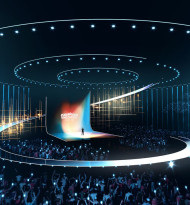WIEN. Wer in den letzten beiden Wochen mit offenen Augen durch das eine oder andere Shopping-Center oder auch den öffentlichen Raum gegangen ist, konnte auf einem Screen die Weltmeisterfahrt im Super G von Stephanie Venier und rot-weiß-roten Freudentaumel sehen. Erstmals überhaupt wurden Liveübertragungen der Alpinen Ski-WM auf den DOOH-Screens von Gewista gezeigt.
Aber wie ist dies überhaupt technisch möglich? Und welche Herausforderungen verstecken sich in der Umsetzung? Darüber gibt Chief Digital Officer Florian Wagner Auskunft. Am Anfang stehen rechtliche Fragen, etwa, wo und wie viele Screens bespielt werden können. Wer im Auto sitzt und fährt, soll auch vom bemerkenswertesten Husarenritt nicht abgelenkt werden: „Wir sind regulativ eindeutig und nutzen auch keine Grauzonen aus.”
Sicherheit im Vordergrund
Hinsichtlich zukünftiger Möglichkeiten mit der Einbindung von YouTube- oder Twitch-Streams setzt man auf Livebilder via Internetsignal. Das wiederum bedingt, dass viel Programmier-Arbeit anfalle, um auf alle Cyber-Security-Fragen eine Antwort zu haben. „Wenn man es technisch einfach bauen will, hätten wir alle Screens mit Fernsehkarten ausstatten können. Das war aber nicht Sinn und Zweck. Wir wollten ein System bauen, das Livesignale unabhängig von der Herkunft auf die Screens bringt”, so Wagner.
Egal welches Signal hierbei via API-Steuerung ongeboardet wird, muss so gestaltet sein, dass es allenfalls grünes Licht bekommt, ohne dass entlang der Ausspielungskette beteiligte Sicherheitssysteme es blockieren. Seit Sommer 2024 arbeitet man an einer Lösung: „Wenn ich skalieren will, muss es standardisiert ablaufen, ohne für jede Ausspielung immer die selben Sicherheitsfreigaben einholen zu müssen.” So wird dann der digitale Stream in den öffentlichen Raum geholt.
Die vierte Dimension
So ein Großprojekt könne laut Wagner nur mit einem Partner wie dem ORF umgesetzt werden. Die Skiaffinität im Mutterkonzern JCDecaux spielt wohl auch eine Rolle. Denn Sportrechte sind teuer, an einem Handel hat man wenig Interesse. Schließlich sind die Screens ein Massenmedium, das aber keinen Content produziert.
„Das Spannende ist, die digitale Welt in den öffentlichen Raum zu bringen. Das war irgendwie die vierte Dimension. Was ist, wenn eine Marke Influencer für TikToks engagiert und das ist auch draußen zu sehen?”, stellt er in den Raum. Und wer nicht hyperfragmentieren, sondern möglichst viele Menschen erreichen will, schafft das so. Er erinnert daran, dass es vor allem E-Commercler waren, die in den letzten zehn Jahren auf diese Werbeform setzten, weil „sie dort die erreichen, die sie im virtuellen Raum nicht ansprechen”.
Antithese zum Silicon Valley
Diese Umsetzung könnte beim Song Contest oder der Fußballweltmeisterschaft 2026 wieder zum Einsatz kommen. Ein Vorteil: Das in diesem Bereich investierte Geld wird nicht von US- oder sonstigen Techriesen eingeheimst, die sonst mit fremdem Content Geld verdienen. Statt alleine auf das Smartphone zu starren, kann man spannende Momente gemeinsam erleben.
Noch geschieht das ohne Sound, im Innenraum wäre das aber denkbar. Es gefällt jedenfalls: „Ich war im Donauzentrum, da war eine Menschentraube bei Veniers Fahrt, und zwei Herren meinten, sie hätten es verpasst, wenn es hier nicht zu sehen wäre.” Das bringt den Kernwert seiner Firma auf den Punkt: Public Value und Monetarisierung verknüpfen. „Wir geben dem öffentlichen Raum, was ihn interessiert und es nicht gab und spannen es mit der Werbewirtschaft zusammen.” (fej/gs)